Hell wird es hier erst sehr spät
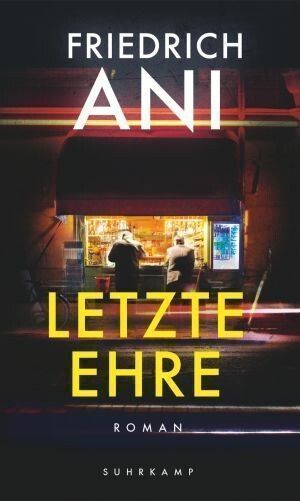
Letzte Ehre
Friedrich Ani
Suhrkamp
270 Seiten
Zwei Fürsten der Dunkelheit geben sich die Ehre, Friedrich Ani und Robert Preis.
Romane „Letzte Ehre“ heißt Friedrich Anis neuer Roman, in dem er wieder über den Großraum München düstere Wolken aufziehen lässt. Finja, eine Schülerin, kam von einer Party nicht nach Hause. Oberkommissarin Fariza Nasri gefällt das von Anfang an nicht und sie beginnt sich nun umzuhören, immer wieder bleibt sie beim Lebensgefährten der Mutter hängen, der sehr großzügig sein Haus für die Partys der Jugendlichen zur Verfügung stellte. Schichtenweise legt Nasri das Verbrechen frei und landet dabei immer wieder bei anderen Gräueltaten, kleine und große, alle gegen Frauen gerichtet, alle so lange unter der Oberfläche, bis sich jemand der Sache annimmt.
Es ist nichts Spektakuläres dabei, vielleicht ist aber gerade das der Moment, an dem die Geschichten am glaubwürdigsten klingen. Um die Bildersprache zu befeuern, bereichert Ani seine Geschichten mit einer unheimlich detailierten Schilderung, als würde er Orte und Erlebnisse, die er in München auf seinen Recherchegängen gesehen hat, in sich abspeichern und sukzessive auf Papier bringen. Wahrscheinlich spielen hier seine Tätigkeiten am Polizeifunk mit, denen er vor seiner literarischen Karriere nachging. Dazu kommen die vielen Gespräche und Verhöre, die Fariza Nasri führt, dieses unglaublich rhythmische Erzählen der Befragten, die den Roman beflügeln und in eine gewisse Richtung treiben. Aber in eine wirklich erwünschte Richtung? Das ist jetzt die Frage. Der Großmeister des Subtilen findet dieses Mal zu viele Anfänge und zu wenige Enden, da geht der rote Faden verloren. Der Roman wurde sehr oft umgeschrieben, erzählt man sich, und auch der langjährige Suhrkamp-Kultlektor Raimund Fellinger konnte die Endfassung des Romans nicht mehr betreuen. Das Böse schreit vom Himmel, Gefühle werden wie durch einen Verstärker manifestiert, dennoch bleiben die Wege verschleiert.
Studierter Ethnologe
Mit mystischen Gegebenheiten wird auch Armin Trost konfrontiert. Im siebten Roman von Robert Preis macht er den Großraum Graz unsicher. Trost ist ein sympathischer, dem südsteirischen Wein leicht verfallener Antiheld, der sich gekonnt auf alle privaten Schwierigkeiten einlässt. Ein Einstieg in Fall 7 ist ohne Vorwissen möglich. Preis spricht die Befindlichkeiten des Ermittlers an, gut dosiert, sodass der Leser sich auskennt, doch geht er dann gleich ins Inhaltliche über: In Graz bekommen sämtliche Landesräte einen identen Drohbrief zugeschickt, in denen im Namen historischer Vorfahren, bis hin zur Keltenlegende Atnamech, ihr baldiger gewaltsamer Tod vorausgesagt wird. Ein strittiger Autobahnausbau scheint das auslösende Moment der Erzürnung zu sein. Atnamech und seine Krieger tauchen im Roman immer wieder auf, denn tatsächlich wird einem ehemaligen Richter, der sich mit einem Autobahnprojekt beschäftigt, und dessen Gattin, einer Landesrätin, mit keltischen Originalwaffen der Garaus gemacht. Als sich Trost nicht davon abhalten lässt, in Wundschuh und im benachbarten Kaiserwald nach dunklen Geheimnissen zu suchen, werden er und eine Historikerin plötzlich selber zu den Gejagten.
Glücklicherweise ist Robert Preis ein studierter Ethnologe, seine Geschichten haben Hand und Fuß, wenn man sich auf sie einlässt. Des Lesers Plan müsste wie folgt sein: „Der Fall des Grazer Königs“ lesen, sich dabei auf den Urlaub in der Südsteiermark freuen und kurz nach Graz wirklich bei der A9-Autobahnabfahrt Schachenwald in den Kaiserwald schauen, ob es dort mit rechten Dingen zugeht.
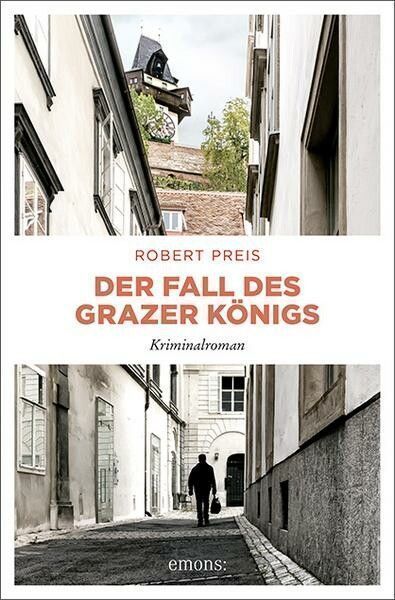
Der Fall des Grazer Königs
Robert Preis
Emons
298 Seiten