Die Zwischenbilanz einer Autorin
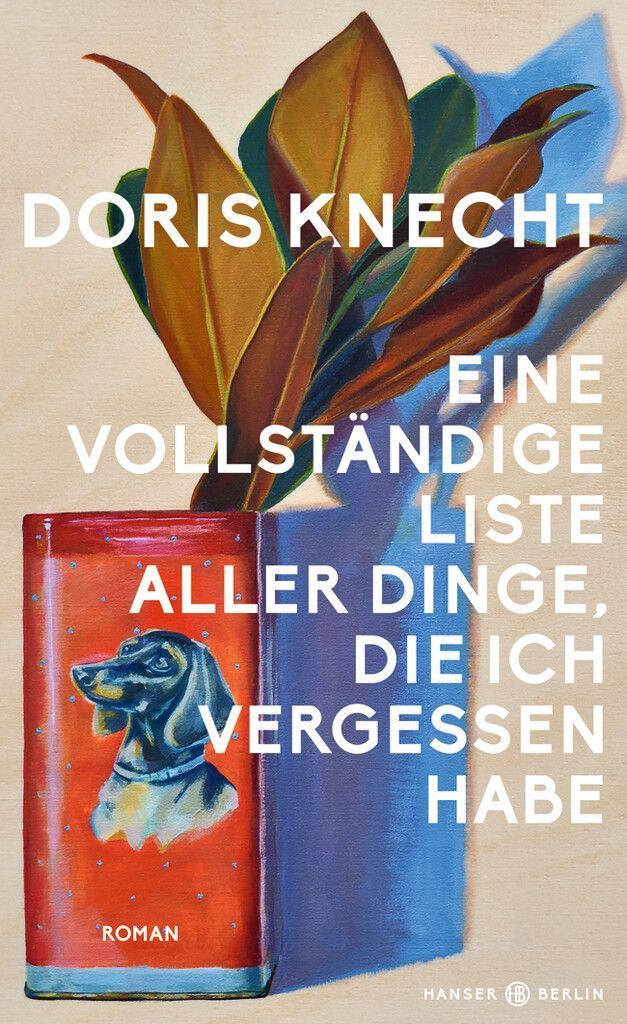
Eine vollständige Liste der Dinge, die ich vergessen habe
Doris Knecht, Hanser Berlin,
240 Seiten
Doris Knecht packt die Kisten, nicht die ihren, sondern die ihrer Ich-Erzählerin.
Roman „Das bin nicht ich, oder fast nicht“, verrät Doris Knecht gleich zu Beginn ihres Romans „Eine vollständige Liste der Dinge, die ich vergessen habe“ und auch das private Umfeld der Ich-Erzählerin entspringt der Fantasie der Autorin. Tatsächlich geht es um ein Mädchen in den 1980er-Jahren, das von der Landluft genug hat und nichts anders vorhat, als Teil der Wiener Szene zu werden und schlussendlich als Journalistin, Autorin und Alleinerzieherin in der Lebensmitte eine nüchterne Bilanz zieht: Sobald die Kinder der häuslichen Obhut entgleiten, und mit ihnen auch die Alimente, mit denen die Autorin einen Teil der Miete finanziert, wird es etwas knapp, sehr knapp sogar, eigentlich kann sich das nicht mehr ausgehen. Handeln ist angesagt.
Die Position ist jetzt nicht einfach, es gilt zum einen das Leben, das man führte, zu verteidigen, in dem man unter anderem ferne Länder kennenlernte, ein Teil der Wiener Brunnenmarkt-Bohème wurde, U4, Blue Box, unterkühlte WG-Wohnungen sein Umfeld nennen durfte und eben Sprosse für Sprosse den Job als Journalistin und Autorin erklomm. Zum anderen liegt eine Auseinandersetzung mit dem Gegenüber nahe: Den „funktionierenden“ Schwestern, die am Land geblieben sind und die Tradition der Eltern-Generation fortsetzen. Daneben wachsen die eigenen Kinder hurtig heran, wollen endlich Tattoos, müssen mit Fernunterricht heil durch die Covid-Zeit gebracht werden, und persönlich muss man eben auch schauen, wie man samt Hund, Freundinnen und Wunschvorstellungen nicht an der Realität zerschellt – viel zu tun also.
Das Angenehme an der „vollständigen Liste“ ist, dass die Autorin weder im Selbstmitleid ersäuft noch die Menschen verurteilt, die andere, ebenfalls nicht risikofreie Wege gewählt haben. Knechts Ich-Erzählerin war in WGs unterwegs, wo man im Vorraum im Winter noch Holz zum Heizen hackte, billigen Fusel trank und bei Kerzenlicht Allianzen schmiedete. Gegensätzlich zum Wildromantischen hatte sie zwei Abtreibungen am Wiener Fleischmarkt in einer Zeit, als dort noch dagegen demonstriert wurde, und wurde bei der Geburt der eigenen Kinder vom Spitalpersonal verachtet, als sie nicht stillen konnte. Das sind ungeschönte Momentaufnahmen, die Teil eines persönlichen Konstrukts der Ich-Erzählerin sind, in dem die positive Sichtweise dennoch tonangebend ist: Zum Beispiel die Freude als Alleinerzieherin mit den Zwillingen zu dritt gewesen zu sein, dazu wird auch die eigene Liebe zum ländlichen Raum entwickelt. Knechts Roman ist ein feines Zeitdokument einer Epoche, die mit der Rebellion im Mikrokosmos und mit gesellschaftlichen Veränderungen im Millimeterbereich vorliebnehmen musste.
Einmal Ghetto, immer Ghetto
Arielle Freytag ist bei ihrer Großmutter Varuna in einer heruntergekommenen Brennpunkt-Siedlung in Essen aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt und ihre Mutter verschwand spurlos, als Arielle noch ein Kind war. Mittlerweile ist Arielle Anfang 30, sozial aufgestiegen und arbeitet als Social-Media-Managerin in Düsseldorf – ihre Wurzeln meidet sie. Plötzlich bekommt sie von einer Sozialarbeiterin einen Anruf, dass Varuna aufgrund eines Knochenbruchs Unterstützung bei alltäglichen Erledigungen benötigt. Nach langem Überlegen beschließt Arielle, in ihre Heimat zurückzukehren, wo sie alte Gesichter wiedererkennt, mit vergangenen Problemen konfrontiert wird und feststellt, dass sie das Ghetto nie wirklich verlassen hat. Lisa Roy spricht in ihrem Debütroman „Keine gute Geschichte“ schwere Themen an, wie Armut, Migration, psychische Probleme und die Suche nach der eigenen Familie.
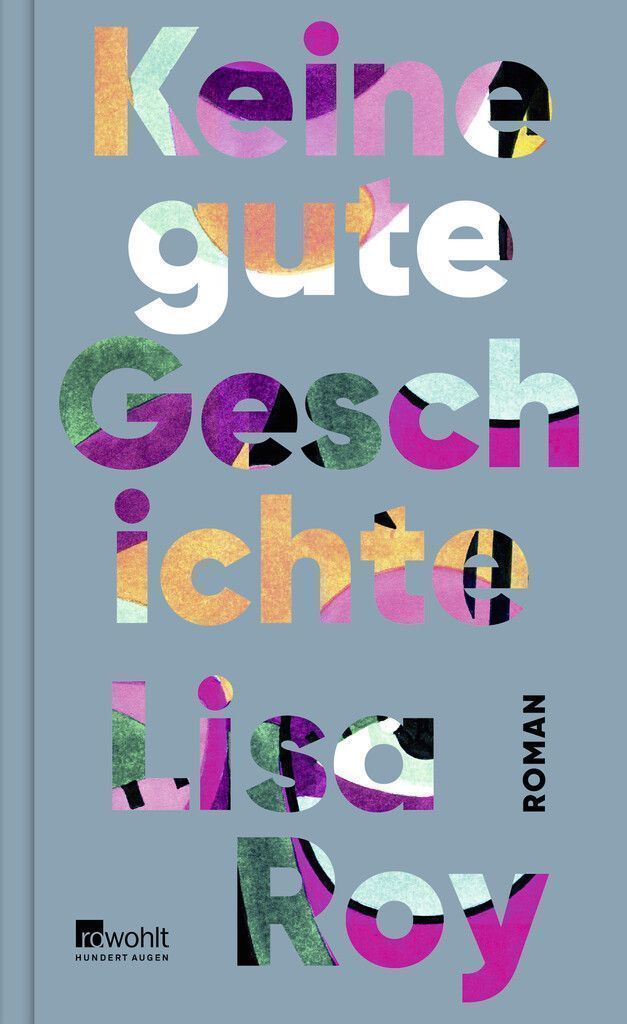
Keine gute
Geschichte
Lisa Roy, Rowohlt, 236 Seiten