„Mama Odessa“ – Die Nähe in großer Ferne
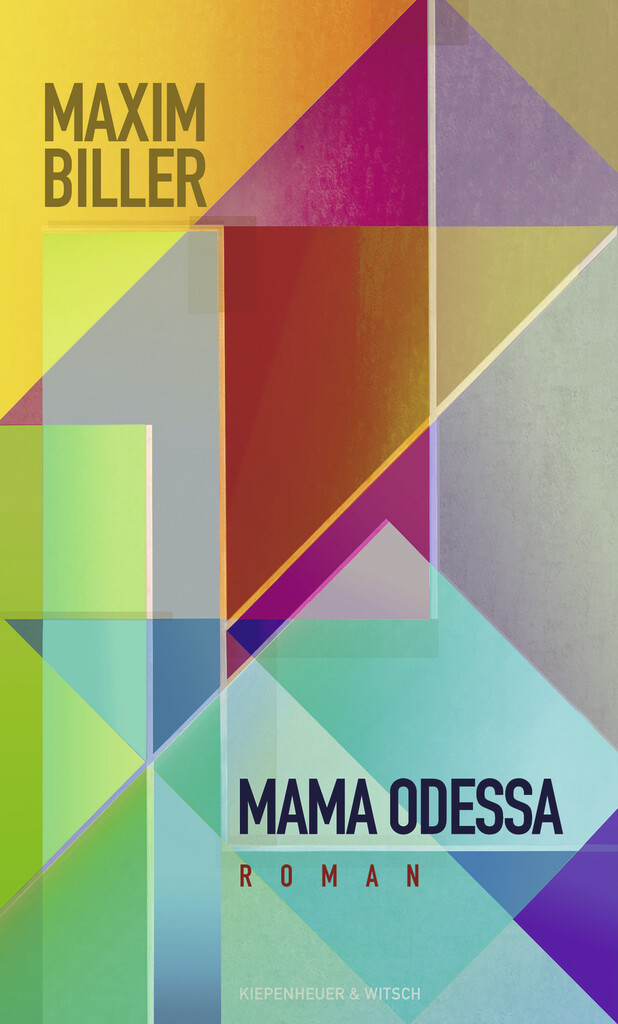
Mama Odessa
Maxim Biller, Kiepenheuer&Witsch,
232 Seiten
Einmal mehr durchlüftet Maxim Biller sein Familienelaborat, dieses schwemmt erstaunliche Fundstücke an die Oberfläche.
FAMILIENROMAN Nach dem Tod von Maxim Billers Mutter obliegt ihm die Aufgabe, ihre Wohnung zu räumen. Eine leidenschaftliche Aufgabe, wenn man bedenkt, dass seine Romane erst griffen, als das Leben seiner Vorfahren, und ein wenig auch seines, die inhaltliche Grundlage war: Die Billers sind Moskauer Juden, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach Odessa flüchteten und schließlich auf der Flucht vor Stalin als Immigranten in Hamburg landeten. Mit viel Wissen, Kunst und Religion im Background hat der Autor also viel zu erzählen. Aber dieses Mal, in „Mama Odessa“, wollte er „Wirklichkeit, nicht bloß Literatur“.
Katz-und-Maus-Spiel
Ist ihm das gelungen, darf man sich nach der Lektüre fragen. Bittersüß, könnte die Antwort lauten, also zwischen allem. Warum nicht nur süß? Der Leser bleibt etwas unbefriedigt, weil er weiß, dass Biller nie bei sich ankommt. Der Autor lässt die Geschichten und seine Familie bis auf einen gewissen Moment zu, verarbeitet diesen und stößt das Konvolut an Gedanken wieder ab. Wie ein Kätzchen, das mit einer noch halb lebendigen Maus spielt, um sie dann „für spätere Spielereien“ dennoch am Leben zu lassen. Natürlich, Billers Leben ist kein Katz-und-Maus-Spiel, hier geht es geschichtlich bedingt um Mord und Totschlag, aber eben auch um ganz viel Liebe und Zuneigung, gegenübergestellt der Weggang seines Vaters zur „deutschen Nutte“, wie es der Autor als Zitat seiner Mutter formuliert. Berührend, wie seine Mama noch im hohen Alter Literatin wird und ihr der Sohn in einem Akt der Hilflosigkeit dennoch die Weichen stellt. Sich nicht ganz zulassen hat natürlich Methode. So lässt sich die Geschichte weiterspinnen, erneut kann ein Aufguss gebrüht werden, der schlussendlich ein weiteres Buch ergibt. Aber solange Biller Bilder entwirft, die groß genug sind, um dem politischen Irrsinn, der zurzeit passiert, eine Welt gegenüberzustellen, die fernab jeder Schwarz-Weiß-Malerei existiert, ist dieser Weg allemal richtig. Chapeau!
Gelungenes Spätwerk
Paul Auster, der amerikanische Schriftsteller, Filmregisseur, Drehbuchautor und Übersetzer ist seit den 80er-Jahren und seiner „New-York-Trilogie“ weltbekannt. Nicht nur in New York ging man an Erscheinungstagen seiner Bücher nach dem Kauf fast mit ihnen spazieren – es ist auch heute noch zu sehen. Sein neuer Roman „Baumgartner“ ist einmal mehr ein autobiografisches Werk, in dem der 76-jährige die Beziehung zu seiner Frau und die Vergänglichkeit der Zeit thematisiert – so leidet der Autor mittlerweile an Krebs.
Zum Inhalt: Der alleinstehende, emeritierte Professor Seymour, Sy, Baumgartner ist 70 Jahre alt und vertreibt sich seine Zeit mit dem Verfassen von philosophischen Büchern. Sehr alleine, denn Sy hat vor zehn Jahren seine Ehefrau Anna bei einem Unfall während des Urlaubs verloren. Der Protagonist kommt über Annas Tod nur schwer hinweg und schwelgt in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Ihr Nachlass zieht sich künstlich in die Länge und die Partnerschaft mit Judith scheitert, weil Sy seine verstorbene Frau in Judith sehen will.
Der Plot hat in Wirklichkeit keinen Zusammenhang – er besteht aus Erinnerungen, Gedichten und Kurzgeschichten von Anna und Anekdoten aus Sys Leben. Inhaltlich gestaltet sich der Stoff kontrastreich: Liebe, Tod, jung und alt. Auster thematisiert das Vereinsamen alter Menschen, den Verlust einer nahestehenden Person und die psychischen Folgen eines solchen Schicksalsschlags, dabei wirkt der Roman allerdings zu keiner Zeit verbittert. Besonders mit dem Wissen, dass Auster an Krebs leidet, nimmt der Roman andere Dimensionen an und geht unter die Haut.
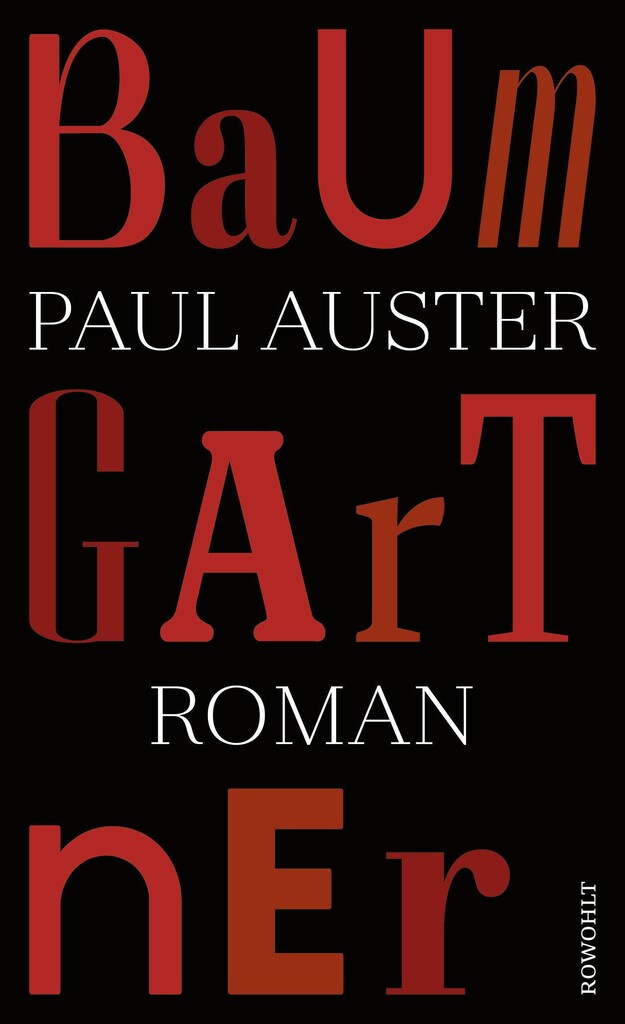
Baumgartner
Paul Auster, Rowohlt, 203 Seiten