Diktatoren hassen Intellektuelle

VN-Interview mit Michael Köhlmeier (74), Schriftsteller.
Hohenems In einem intelligenten, spannenden und weitsichtigen Roman wirft der Vorarlberger Autor Michael Köhlmeier einen Blick zurück in die russischen Revolutionsjahre und spannt den Bogen bis in die heutige Zeit.
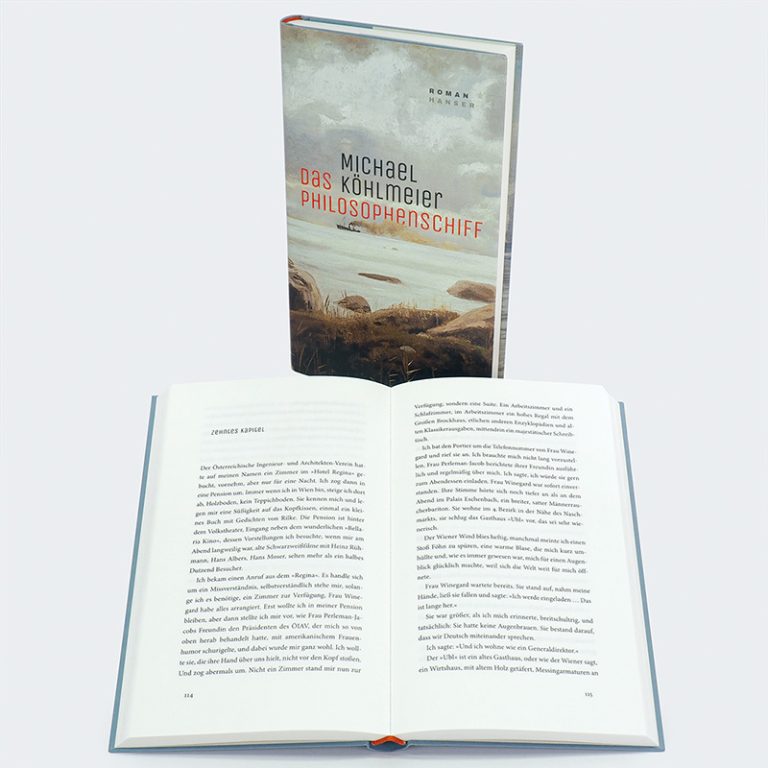
Warum haben Sie Ihren Roman in Russland (und keinem anderen Land) des letzten Jahrhunderts angesiedelt?
Die Geschichte spielt nun einmal in Russland. Im Jahr 1922. Was damals dort geschah, die Revolution, die eigentlich ein Putsch war, hat eine Schockwelle ausgelöst, die bis heute nachwirkt. Bilden wir uns nur ja nicht ein, wir hätten die Geschichte des 20. Jahrhunderts schon aufgearbeitet. Wir haben sie noch nicht einmal begriffen! In weiteren hundert Jahren wird man sagen, es war die gewalttätigste, aber auch faszinierendste Zeit der Menschheit. Das Jahrhundert der Ideologien. Der Glaube, es sei etwas Gutes, an das Gute zu glauben, der ist uns – vielleicht für immer – genommen worden.
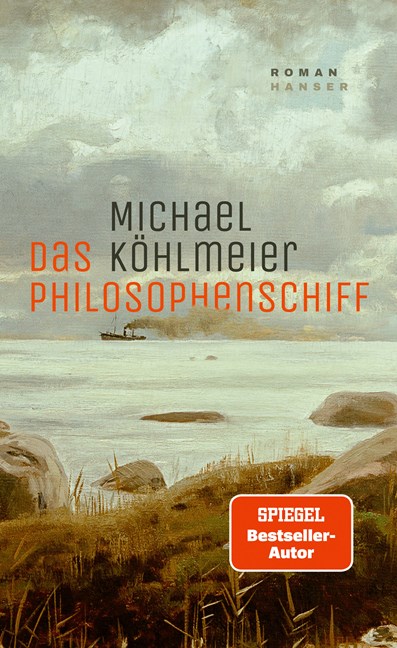
Ihre Hauptprotagonistin, die 100-jährige Architektur-Professorin Anouk Perleman-Jacob, erinnert mich an die österreichische Architektin Margarete-Schütte-Lihotzky – ein Zufall?
Kein Zufall. Ich habe Margarete-Schütte-Lihotzky kennengelernt, da war sie 102 Jahre alt. Die Begegnung hat mich tief beeindruckt. Ich habe mich eine Stunde lang mit ihr unterhalten. Mein Gott … ein Mensch, dessen Leben diese Zeit umschließt! Meine Anouk Perleman-Jacob hat eine andere Geschichte, ich habe mich nicht an der Biografie von Margarete-Schütte-Lihotzky orientiert. Lesen Sie die Parallele als eine Hommage.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit dem Philosophenschiff einen Roman zu machen?
Ich habe von den Schiffen gelesen, auf die Hunderte Intellektuelle verfrachtet und aus der Sowjetunion ausgewiesen wurden. Ich habe gelesen, wie Trotzki diese Aktion vor der internationalen Presse gerechtfertigt hat. Diese Menschen seien keine zuverlässigen Zeitgenossen, irgendwann werden sie sich gegen die Bolschewiki wenden, und dann wird man sie erschießen müssen. Trotzki bat die Journalisten, in ihren Zeitungen die Ausweisung als einen Akt der Humanität darzustellen. Der Begriff „Philosophenschiff“ hat mich inspiriert. Das klingt doch nach Frieden, nach Freundlichkeit, Nachdenken, Diskutieren, Zuhören … „Philosophenschiff“ – das hat mich an das Philosophicum in Lech erinnert … Und dann stellt sich heraus, es ist etwas sehr Böses … das einem noch viel Böserem vorausgegangen ist.

Haben Sie Nikolai Gumiljow schwer zu deutendes Gedicht, welches er für Anouk Perleman-Jacob geschrieben hat, selbst analysiert?
Dieses Gedicht ist nicht erfunden. Nie wieder sind so viele rätselhafte Gedichte geschrieben worden wie zu jener Zeit in Russland. Hätten die Kommunisten nicht mit den Intellektuellen, den Dichtern und Philosophen und allen anderen, auf so brutale Art aufgeräumt, was hätte sich für ein poetisches Blumenmeer über ganz Europa, die ganze Welt ausgebreitet! Ja, ich habe versucht, das Gedicht zu interpretieren. Es gibt keine Auflösung. Das Rätsel bleibt. Und das ist gut so. Sobald ein poetisches Gebilde bis auf den Boden ausgeleuchtet ist, wird es langweilig. Wird zu Stein. Das Provokante an guter Lyrik ist, dass wir sie nie ganz verstehen können. Das trifft auf alle Kunst zu. Das mag auch der Grund sein, warum manche Menschen Kunst und Literatur hassen.
Am Philosophenschiff lautet die Devise „Keiner traut keinem“. Die Angst bespitzelt zu werden, muss unheimlich groß gewesen sein, oder?
So ist es in jeder Diktatur. Diktaturen beruhen auf Drohung und Angst.
Sie schreiben, u. a., es gab in der Geheimpolizei GPU auch eine Sonderkommission, die Gedichte analysierte. Hatte man vor den Intellektuellen Angst?
Diktaturen hassen die Intellektuellen. Es ist leicht, einen Teil der Bevölkerung gegen Intellektuelle aufzuhetzen. Es gibt viele Menschen, die sind unzufrieden, fühlen sich gedemütigt, nicht ästimiert, viele wollen einen Schuldigen. Zu allen Zeiten deutete der Finger des Diktators auf die Intellektuellen. Augustus zeigte auf Ovid, die Kirche am Ende des Mittelalters auf Giordano Bruno, Hitler auf Hunderte Männer und Frauen. Und Lenin, Trotzki und Stalin taten das auch. Der durchschnittliche Lebensstandard der Schriftsteller in Österreich liegt unter der Armutsgrenze, und dennoch werden sie immer wieder angepöbelt, sie hocken dem Steuerzahler auf der Tasche. Damit lässt sich leicht aufhetzen. Das hat Jörg Haider gegen H. C. Artmann getan. Als der Dichter tot war, ist er geehrt worden. Dann kriegt der Dichter eine Briefmarke.

Sie lassen in Unterbrechungen immer wieder das heutige, fiktive Leben der Architektin einfließen. Unter anderen war sie bei einer Feier, wo auch der ehemalige FPÖ-Parteichef Jörg Haider war. Perleman-Jacob bezeichnet Jörg Haider als „gescheiten dummen Buben“. Wo ist für Sie der Unterschied zwischen Jörg Haider und Herbert Kickl zu sehen?
Herbert Kickl war der Redenschreiber von Haider und ist von diesem unter dem Tisch versteckt worden. Gedemütigte sind gefährlich. Haider war ein Spieler, der am Ende alles verloren hat und mit ihm ein ganzes Bundesland. Wenn ich in Herbert Kickls ängstlich aufgerissene Augen sehe, ahne ich einen Gedemütigten. Er ruft die Menschen zur Rache auf.
Hinter dem Haus am Land, das besichtigt wird, wurde jemand aufgehängt. Habe ich überlesen, wer das ist?
Sie haben es nicht überlesen. Zu dieser Zeit hat man nicht viel gefragt, wenn einer aufgehängt wurde. Warum fragst du? Kanntest du ihn? Habt ihr gemeinsame Sache gemacht? Da fragt man lieber nicht.
Was ist der Unterschied zwischen dem Russland des 20. Jahrhunderts und heute?
Herr Putin ist ein Nachfahre von Lenin und Stalin. Er ist ein Mann des Sowjetischen Geheimdienstes. Ausgebildet vom KGB. Das meinte ich mit der Schockwelle.
Sie haben eindringliche Zitate im Buch. Eines davon ist: „Du wolltest dem Menschen befehlen, frei zu sein.“ Wollen Sie dazu noch etwas sagen?
Ich mag meine Bücher nicht interpretieren. Das können Sie besser.
Herr Köhlmeier, wir danken für das Gespräch.
Martin G. Wanko
Michael Köhlmeier: „Das Philosophenschiff“, Hanser, 221 Seiten, erscheint am 29.01.2024