EU schreibt Gehaltstransparenz vor: Was auf Firmen zukommt

Ab Juni 2026 gilt neue Richtlinie – eine FH-Studie zeigt, wie Vorarlbergs Betriebe darauf vorbereitet sind.
Dornbirn Ab Juni 2026 wird es ernst: Mit der neuen EU-Entgelttransparenz-Richtlinie sind Unternehmen verpflichtet, deutlich offener mit Gehältern umzugehen. So müssen etwa im Stelleninserat oder vor dem Bewerbungsgespräch realistische Einstiegsgehälter genannt werden. Gleichzeitig ist es Arbeitgebern untersagt, Bewerber nach ihrem bisherigen Einkommen zu fragen. Beschäftigte wiederum erhalten das Recht, Auskunft über das durchschnittliche Gehalt vergleichbarer Tätigkeiten einzufordern.

Unterschiede bei Branchen
Eine aktuelle Erhebung der Fachhochschule Vorarlberg unter mittleren und größeren Betrieben zeigt nun, wie vorbereitet die Unternehmen sind. „Es ist ein gemischtes Bild. Derzeit stellen nur 30 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitenden interne Vergleichswerte zu gleichwertigen Positionen zur Verfügung“, erklärt Studienautor Hannes Tschütscher, Dozent für Personalmanagement und Arbeitspsychologie. Auffällig seien die Unterschiede zwischen den Branchen: Während in vielen öffentlichen Organisationen Transparenz bereits Standard sei, gaben lediglich zwölf Prozent der Industrieunternehmen an, solche Daten bereitzustellen.
Realistische Einstiegsgehälter
Bei Stellenanzeigen weisen 43 Prozent der befragten Personalverantwortlichen bereits realistische Einstiegsgehälter aus. Bislang war in Österreich lediglich die Angabe des kollektivvertraglichen Mindestentgelts vorgeschrieben. „Sinnvoller wären realistische Gehaltsspannen, die geschlechtsspezifische Unterschiede ausschließen“, betont Tschütscher.

Hintergrund der Richtlinie ist die Schließung des Gender Pay Gap – also der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Laut Eurostat liegt dieser in Österreich bei 18 Prozent. Künftig müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden jährlich, Betriebe mit 100 bis 249 Beschäftigten alle drei Jahre, entsprechende Daten an eine nationale Behörde melden. „Weist ein Bericht ein Lohngefälle von mehr als fünf Prozent auf, das nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien erklärbar ist, sind Unternehmen verpflichtet, Maßnahmen in Form einer gemeinsamen Entgeltbewertung zu ergreifen“, erläutert der Studienautor.
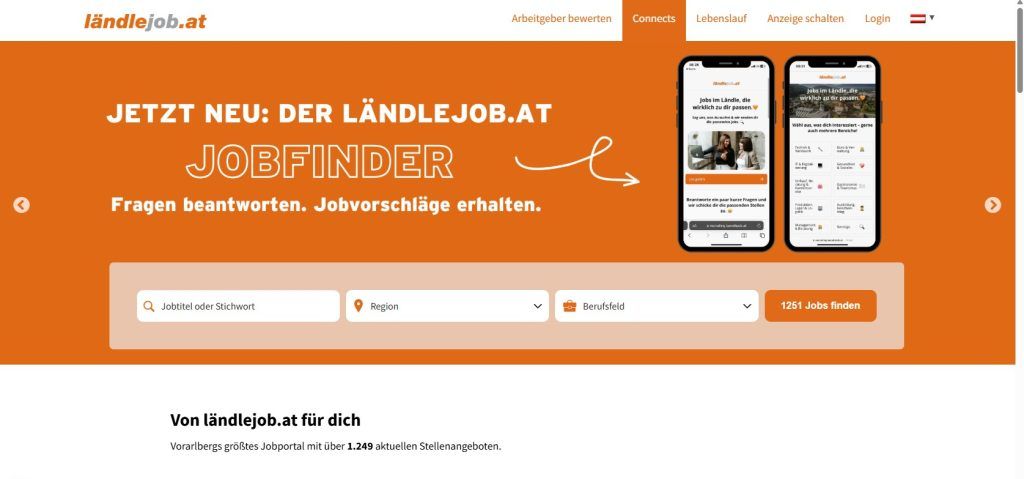
Schritt zur Gleichbehandlung
Ob dies tatsächlich mehr Gleichbehandlung bringt, hänge stark von der nationalen Umsetzung ab. Klar sei aber: Mitarbeitende, die geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung erfahren haben, können künftig Schadenersatz einfordern, inklusive Nachzahlung entgangener Entgelte. „Das kann erhebliche Auswirkungen auf die Reputation von Unternehmen haben“, so Tschütscher.
Welche Effekte Transparenz in der Praxis hat? Hier ist die Forschung ambivalent: Wird zu wenig offengelegt, empfinden Mitarbeitende das System oft als ungerecht – während Führungskräfte größere Spielräume behalten. „Offenheit schafft zwar mehr Nachvollziehbarkeit, kann aber auch Neid und Abwanderungstendenzen verstärken, wenn sich Beschäftigte benachteiligt fühlen“, sagt der Dozent. Zudem neigen Unternehmen dazu, aus Angst vor Konflikten, Gehaltsunterschiede zu glätten – wodurch sich die Entlohnung von leistungsstarken und weniger leistungsstarken Mitarbeitenden angleichen.
Risiko neuer Spannungen
„Gehaltstransparenz kann zu mehr Gerechtigkeit führen, birgt aber auch das Risiko neuer Spannungen“, fasst Tschütscher zusammen. Die eigentliche Herausforderung für Betriebe liege deshalb nicht nur in der Offenlegung von Zahlen, sondern in der verständlichen Kommunikation von Prozessen und Kriterien.