“Herumgemosert”: Wie man Seuchen nicht bekämpft
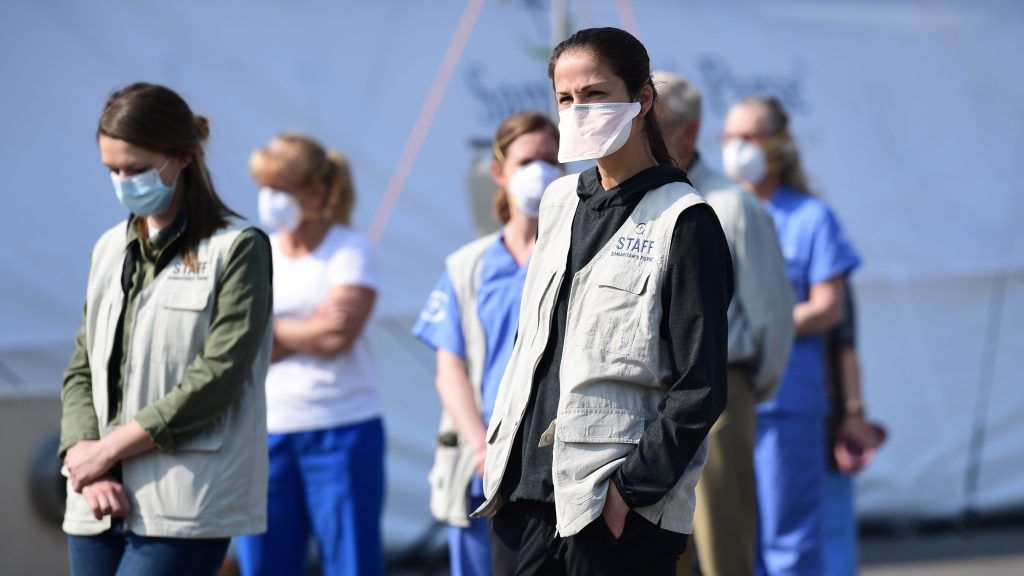
Österreich ist nicht gerade dafür bekannt, auf Herausforderungen besonders schnell und entschieden zu reagieren. Umso besser, dass man bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie eine Ausnahme macht. Welche Auswirkungen zögerliches Handeln hier haben kann, zeigt die Vergangenheit: Die spanische Grippe breitete sich 1918 von Westeuropa Richtung Vorarlberg aus. Die Regierung in Wien schickte bereits im August den Seuchenexperten Obersanitätsrat Prof. Dr. Ghon nach Vorarlberg. Dieser stellte aber nur fest, dass es sich bei den hierzulande auftretenden Erkrankungen um die Spanische Grippe und nicht die Pest handelte. Die bereits verhängte Sperre der Schweizer Grenze wurde wieder aufgehoben. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, wie das „Vorarlberger Volksblatt“ kritisierte.
Die Bekämpfung der Seuche scheiterte einerseits daran, dass man sie mit damaligen Mitteln nur schwer diagnostizieren und von einer herkömmlichen Grippe unterscheiden konnte, andererseits fehlten kriegsbedingt überall Ressourcen. Die Ernährungslage war schlecht, was die Bevölkerung dem Virus zusätzlich aussetzte. Am 15. September 1918 berichtete das „Volksblatt“ aus den Rheintalgemeinden: „Nun haben Personen, die in der Schweiz arbeiten, die Epidemie gründlich hereingebracht, ganze Familien wurden hier von der unheimlichen Krankheit befallen, ja sogar zwei Todesopfer hat sie hier schon gefordert, eine Frau und ein Mädchen.“ Die Spanische Grippe raffte auch viele junge Menschen hinweg. Die Situation wurde dennoch weiter unterschätzt. Am 21. September brachte das „Volksblatt“ die eher intelligenzbefreite Meldung aus Meiningen, dass die Spanische Grippe „den Rhein bei uns als Grenze zu respektieren“ scheine. Da war die Seuche längst verbreitet. In den Zeitungen blieb sie, trotz der hohen Infektionszahlen, häufig eine Randerscheinung. Es galt noch immer die Kriegszensur. Wie schnell die Grippe sich ausbreitete, zeigte das Feldkircher Staatsgymnasium: Am Montag, dem 23. September, waren 62 Schüler erkrankt, am Tag darauf bereits 99, am Mittwoch waren es 125. Am 26. September erschien „nur noch ein kleines Häuflein“ zum Unterricht. Erst da wurde die Schule geschlossen.
Am 1. Oktober waren allein in Lustenau etwa 1.000 Menschen erkrankt, ein Fünftel der damaligen Bevölkerung. Dort starben fünf Menschen an nur einem Tag. In Dornbirn stieg die Zahl der Erkrankten zur selben Zeit auf 2.000, nach einer Woche auf 3.000. Die Behörden reagierten viel zu spät und uneinheitlich. Wie viele Menschen tatsächlich an der Pandemie starben, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Die Zahlen schwanken österreichweit zwischen 18.500 und 21.000. Die Spanische Grippe wurde auch nie zur anzeigepflichtigen Krankheit erklärt – es gab einfach zu viele Fälle.