Auf der Suche nach außerirdischem Leben
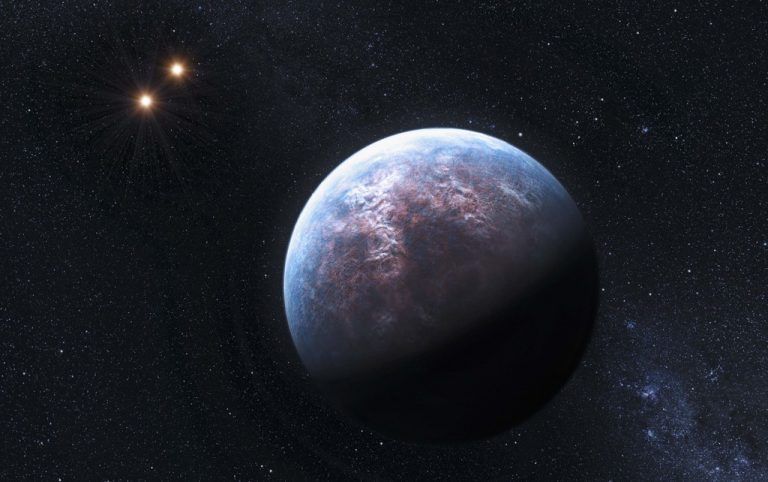
Ein schmales Band am Firmament soll für gezielte Suche besonders geeignet sein.
Köln. Schon lange suchen Forscher vergeblich nach Signalen von Außerirdischen. Nun wollen zwei Astronomen
ein vielversprechendes Himmelsareal für die gezielte Suche nach Signalen außerirdischer Intelligenz ausgemacht haben: In einem schmalen Himmelsstreifen könnte die Wahrscheinlichkeit für das Aufspüren außerirdischer Botschaften deutlich höher sein als anderswo am Firmament, wie zwei an Max-Planck-Instituten tätige Wissenschafter in einer veröffentlichten Untersuchung herausfanden.
Die Forscher schlagen vor, diesem Himmelsstreifen bei künftigen Horchaktionen ins All „höchste Prioriät“ einzuräumen. Trotz jahrzehntelanger Suche vor allem mit großen Radioteleskopen gelang es Forschern bisher nicht, Signale möglicher intelligenter Lebewesen von fremden Planeten aufzuspüren. Möglicherweise waren bei der bisherigen Suche die Schwerpunkte nicht richtig gesetzt, glauben Rene Heller vom Göttinger Max-
Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) und Ralph Pudritz von der
McMaster Universität in Kanada, der zur Zeit am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) arbeitet.
Transitmethode
In ihrer im Fachjournal „Astrobiology“ veröffentlichten Studie regen die Wissenschafter an, die Suche auf einen bestimmten Himmelsbereich zu konzentrieren, nämlich auf das Gebiet, aus dem mögliche ferne Beobachter unseres Sonnensystems den jährlichen Durchgang der Erde vor der Sonne beobachten können. Der Grundgedanke dabei: Solche außerirdischen Beobachter könnten uns bereits gezielte Signale zur Kontaktaufnahme geschickt haben, nachdem sie die Erde mit denselben Methoden entdeckt haben, die auch irdische Astronomen bei der Suche nach fernen Planeten verwenden.
Die meisten der bisher gut 2000 bekannten fernen Planeten fanden die Wissenschafter tatsächlich mit der sogenannten Transitmethode: Zieht ein Planet zwischen seinem Stern und einem Beobachter vorbei, kommt es zu einer vorübergehenden minimalen Verdunkelung des Sterns. Dieser Transit kann dann gemessen werden.
Die Forscher vom MPS und aus Kanada wechselten nun die Perspektive: Angenommen, außerirdische Beobachter nutzen den Erdtransit vor der Sonne zur Erforschung der Erde aus der Ferne: Aus welchem Himmelsbereich müssten sie dann auf unser Sonnensystem blicken? Und aus welchem Blickwinkel würde der Erdtransit vor der Sonne ausreichend lange dauern, um die Erdatmosphäre zu erforschen und Leben nachzuweisen?
Eingegrenzt
Den Forschern zufolge befinden sich die Planetensysteme, von denen aus sich dieser Anblick bietet, in einem schmalen Himmelsstreifen, wobei dessen Fläche nur rund zwei Tausendstel des gesamten Himmels ausmacht. Dabei entspricht der Streifen einer Projektion unserer Sonnenumlaufbahn auf die Himmelssphäre.
In einem weiteren Schritt erstellten die Forscher eine Liste von 82 Sternen, die sich in diesem Himmelsbereich befinden und aufgrund ihrer langen Lebensdauer besonders gute Erfolgsaussichten bieten. Diese 82 Sterne sollten den Wissenschaftern zufolge künftig im Rahmen des Projekts „Search for extraterrestrial Intelligence“ (Seti) höchsten Vorrang erhalten.
Allerdings kennen Astronomen noch bei Weitem nicht alle Sterne unserer Milchstraße. Um abzuschätzen, wie viele Sterne sich über die 82 bekannten hinaus in dem Himmelsstreifen befinden müssten, projizierten Heller und Pudritz den Bereich auf ein Modell für die Sterndichte unserer Galaxie. Ergebnis: Etwa 100.000 Sterne in Sonnennähe könnten Planeten mit Bewohnern beherbergen, die uns entdeckt haben und versuchen, mit uns in Kontakt zu treten.