Lebenswerte Sinnquellen
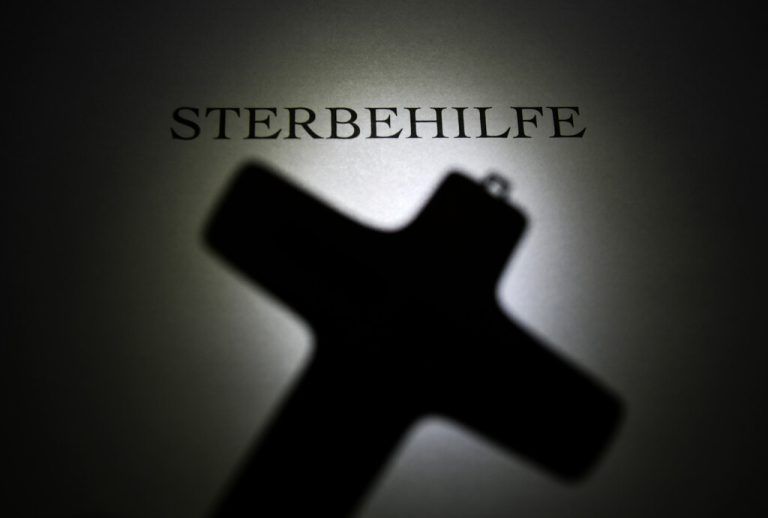
Ethik Tagung zum Sterbeverfügungsgesetz im Bildungshaus Batschuns.
Batschuns Seit 1. Jänner 2022 ist die Beihilfe zur Selbsttötung in Österreich nicht mehr unter Strafe gestellt. Welche Auswirkungen hat diese neue Gesetzgebung für Betroffene, und wie gehen sie damit um? Das war Thema der Ethik Tagung im Bildungshaus Batschuns. Fünf renommierte Referentinnen und Referenten erzählten von ihren Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven.
Um mehr über die Praxis des assistierten Suizids in Österreich zu erfahren und aus den anonym eingereichten Berichten zu lernen, richtete die Österreichische Palliativgesellschaft (OPG) auf ihrer Website die Online-Plattform ASCIRS www.ascirs.at ein. Angelika Feichtner berichtete über die bisher eingegangenen Meldungen, bekannten Motive und Durchführungen ebenso wie über mögliche Komplikationen (eine Publikation ist in Vorbereitung). Laut Gesetz kann niemand zu einer Beihilfe gezwungen werden. Es ist daher zu erwarten, dass vor allem An- und Zugehörige um Beihilfe gebeten werden, also Personen, die in diesem Thema weder ethisch noch medizinisch besonders versiert sind und in ihrer emotionalen Befindlichkeit allein gelassen sein werden.
Zum Positiven gewandelt
Viele Menschen erwägen eine Beihilfe zur Selbsttötung aus Angst vor Schmerz und Leiden. Eine gut ausgebaute Hospiz- und Palliativversorgung kann die Suizidrate mindern, so das Credo der Hospiz- und Palliativbewegung. Wie weit ist der Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Vorarlberg? Dieser Frage ging Univ. Prof. Erika Geser-Engleitner, Soziologin an der FH Dornbirn, nach. Insgesamt hat sich die Hospiz- und Palliativversorgung in Vorarlberg sehr zum Positiven gewandelt. Doch die Vorgaben der Gesundheit Österreich GmbH für spezialisierte Einheiten sind in Vorarlberg noch nicht erfüllt, und das Wissen um die Möglichkeiten der Palliative Care ist in der Gesellschaft noch sehr dürftig: Viele verbinden mit dem Begriff End-of-life-Care. Ein barrierefreier Zugang zu Palliative Care ist noch nicht gegeben, weder für Menschen mit nicht-onkologischen Erkrankungen noch für Kinder, alte oder Menschen mit Beeinträchtigung.
Palliativbedarf erheben
Ein exaktes Monitoring zur Feststellung des Palliativbedarfs im Land wäre zielführend. Dabei sollte auch die Grund- und Langzeitpflege in Blick genommen werden, die 80 bis 90 Prozent der Palliativversorgung leisten. Um die persönliche Position zum assistierten Suizid ging es im dritten Vortrag. Grundsätzlich ist die „hospizliche Haltung nicht mit der Suizidassistenz kompatibel“, zitierte Susanne Kränzle das Eckpunktepapier des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes. Sie schilderte konkrete Situationen aus der Praxis, die Ängste und Nöte, „die Menschen so schwer auf der Seele lasten, dass sie nicht mehr leben wollen“. Aufgabe ist es, gemeinsam zu schauen, ob und wie es Erleichterung geben kann.
Wem gehört das Leben? Bin ich (und mein Sterben) nur mir selbst gegenüber verantwortlich, oder habe ich auch eine Verantwortung gegenüber meiner Umwelt, der Gesellschaft? Diese Fragen warf Albert Lingg, Psychiater und Psychotherapeut, in seinem Vortrag auf. Tatsächlich sei es so, dass viele der Gedanke an ihre Familie, „mitunter sogar an den sich bemühenden Helfer“ vom letzten Schritt abhalte.
Nichts mehr leisten müssen und trotzdem einen Platz in der Gesellschaft haben: Ein Wunsch, den viele Menschen im Alter hegen und dessen Erfüllung in einer leistungsorientierten Gesellschaft immer brüchiger zu werden scheint. Univ. Prof. Schnell aus Innsbruck zeigte verschiedene Möglichkeiten zur Sinnschöpfung auf: „Unser Lebenswille hängt eng damit zusammen, ob wir unser Leben als sinnvoll empfinden, und wie wir Sinn erfahren.“ Sinnquellen zu entdecken und daraus zu schöpfen, ist nicht nur eine individuelle und persönliche Aufgabe, sondern auch eine gesellschaftliche.
„Tatsächlich ist es so, dass der Gedanke an die Familie viele vom letzten Schritt abhält.“
