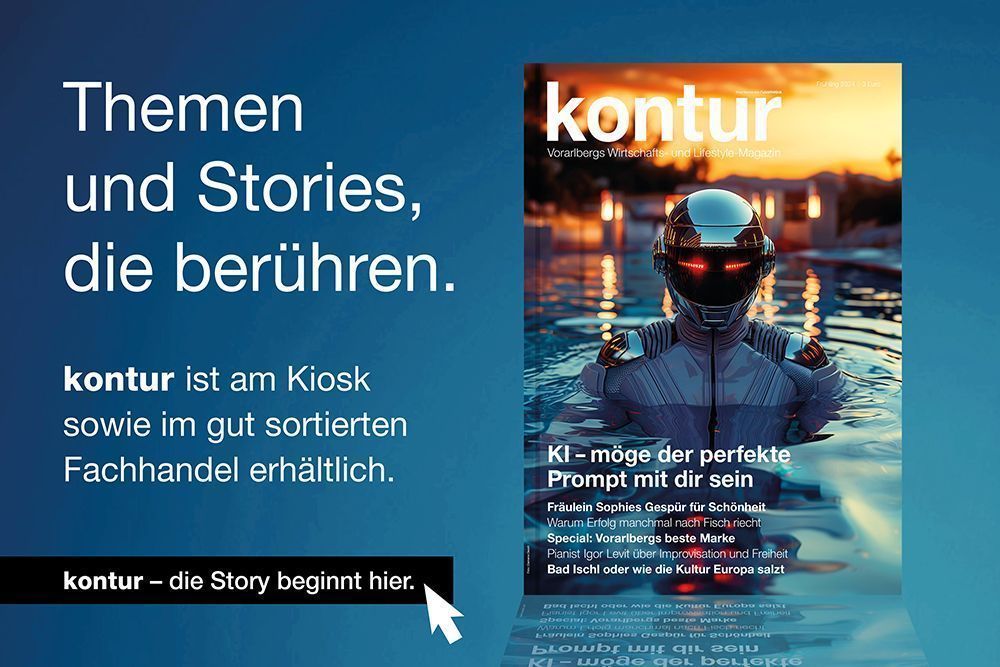Mit Handwerk das Leben gestalten
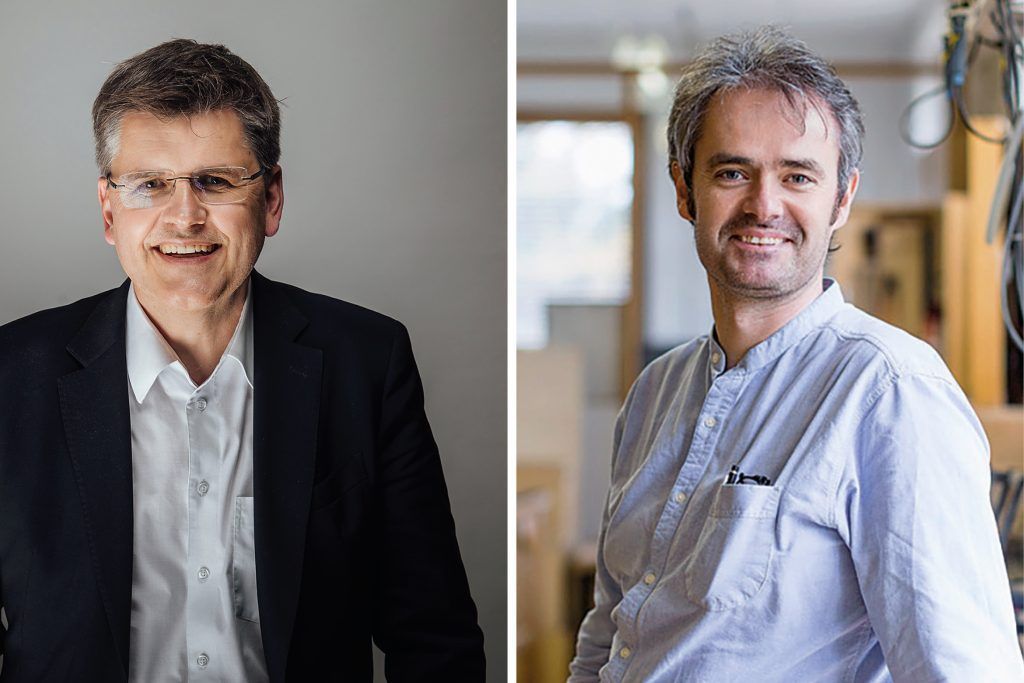
In seiner Funktion bei der Wirtschaftskammer hat Ing. Bernhard Feigl (li.) einen Maßnahmenplan für Handwerksbetriebe mitentwickelt.
Über 12.800 Handwerks- und Gewerbebetriebe im Land spielen über das rein Wirtschaftliche hinaus gerade in den Talschaften eine wichtige Rolle.
Damit leisten sie nicht nur einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag, sondern garantieren durch die Weitergabe ihres Wissens den Fortbestand von Tradition, Erfahrung und qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Das Handwerk ist also insgesamt ein entscheidender Faktor für die ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeit. Handwerksbetriebe und die Menschen, die dahinterstehen, beweisen täglich, dass man gerade in Zeiten der Globalisierung mit Beständigkeit und Mut sehr gut im Wettbewerb bestehen kann. Denn das Handwerk ist in vielen Bereichen auch ein wichtiger Innovationsmotor.
Handwerksbetriebe erfüllen gerade in den ländlichen Strukturen eine wichtige Rolle, weil sie auch für die Vereine und die Dorfgemeinschaft unterstützend wirken. Aber wo liegt die Notwendigkeit und somit auch die Zukunft des Handwerks? Wie gehen Handwerk, Digitalisierung und KI zusammen? Dazu führt Martin Bereuter, Inhaber einer Tischlerei in Lingenau und Architekt, der sich von 2007 bis 2023 im Vorstand des Werkraum Bregenzerwald, davon neun Jahre als Obmann, engagierte, aus:
„Für mich ist die Frage nach der Notwendigkeit des Handwerks wesentlich. Wesentlicher als die Frage, was denn eigentlich ,echtes‘ Handwerk ist. Die Frage stellt sich für mich aus mehreren Blickwinkeln. Da sind einmal die vielen jungen Menschen, die mit ihrer Entscheidung für einen Beruf nicht nur eine Grundlage für ihr wirtschaftliches Auskommen legen, sondern die auch einen Platz, eine Aufgabe in unserer Gesellschaft einnehmen und diese aktiv mitgestalten wollen. Es ist das Handwerk, das in seiner großen Vielfalt für den Erhalt unserer unmittelbaren, kultivierten Umwelt notwendig ist. Das betrifft die persönliche, gleichermaßen wie die kommunale und somit auch die soziale Umwelt. Hier habe ich den Eindruck, dass wir uns als einzelne ebenso wie als Gesellschaft über die gegenseitigen Wechselwirkungen nicht immer im Klaren sind.“ Martin Bereuter erklärt, dass wir über den internationalen Markt die regionale Versorgung regulieren und neben den Vorzügen eines internationalen Angebots auch den Verlust an regionaler Vielfalt und somit auch regionaltypischen Arbeitsplätzen samt dem dazugehörenden Wissen in Kauf nehmen. „Da das Handwerk oft klein strukturiert und regional verwurzelt ist, ist es von dieser Entwicklung besonders betroffen. Ich sehe Parallelen zwischen den aktuellen Fragen der biologischen Vielfalt und der Frage nach einer kreativen und langfristig stabilen regionalen Wirtschaft. Sind es bei der Natur Freiräume für vielfältiges Leben, sind es in der Wirtschaft die vielfältigen Berufsfelder, die traditionelles Wissen spartenübergreifend in die Gegenwart bringen.“
Da die Neugierde schon immer ein Werkzeug des Handwerks war, sei davon auszugehen, dass das Handwerk neue Technologien im Sinne einer Verbesserung der Arbeitsergebnisse in sein Selbstverständnis integrieren wird. „Bei der Digitalisierung sind die Möglichkeiten für das Handwerk aus meiner Sicht schon recht klar umrissen, was die KI betrifft, bin ich selbst sehr gespannt, wie sich Handwerk und KI vertragen.“
In Zeiten der Globalisierung scheinen sich die Menschen wieder mehr für Handwerks-Produkte begeistern zu können. Dazu Martin Bereuter: „Ich glaube, dass das mit dem grundsätzlichen Bedürfnis zusammenhängt, verstehen zu wollen, wie Dinge gemacht sind und wie sie funktionieren. Denn die digitale Welt ist nicht unmittelbar begreifbar. Der Computer war eine Maschine, in der Hardware und Software Aufgaben erledigten, und somit noch dem Prinzip einer Maschine folgten, wie sie uns aus einer Werkstätte bekannt war. Mit dem Wandel zu Mobilgeräten, die im weltweiten Netzwerk agieren, kam ein lange Zeit vertrautes Verhältnis von Mensch und Maschine abhanden. Wer weiß schon wirklich, wie ein iPhone funktioniert? Aber zu entdecken, wie ein bestimmtes Holz in eine bestimmte Form gebracht wird oder zu verstehen, wie ein Schmied Metall bearbeitet, das ist etwas anderes. Ich denke, das hat mit der natürlichen Neugierde des Menschen zu tun. Die Hände können dazu ein sehr effizientes Werkzeug sein, die Welt selbstwirksam und unmittelbar wahrzunehmen.“
Und Martin Bereuter abschließend auf die Frage nach der Rolle der Tradition im Vorarlberger Handwerk: „Tradition spielt im Handwerk grundsätzlich eine Rolle, keine Frage, bei uns allerdings in geringerem Ausmaß als anderswo – weil wir nicht an den traditionellen Formen festgehalten haben. Ich würde vielmehr sagen, dass wir in Vorarlberg traditionelle Bearbeitungsformen in eine neue Zeit geführt haben und oft Materialien verwenden, die dem heutigen Zeitgeist entsprechen, Holz oder Lehm beispielsweise. Tradiertes wird neu umgesetzt und das ist etwas ganz Wesentliches: Denn während Tradition in anderen Regionen eher einen musealen Charakter hat, lassen wir Tradition in unser tägliches Wirtschaften einfließen. Wobei man nicht vergessen darf, dass auch ganz viele Gewerke verschwunden sind. Nämlich alle die Tätigkeiten, die mit der Gebrauchsgüter-Produktion zu tun hatten, wie die Korbflechter, Küfer, Kupferschmiede, Keramiker und viele mehr, die dem Weltmarkt zum Opfer gefallen sind.“
Auftrag zur Ausbildung.
Der Auftrag zur Ausbildung und Weitergabe von Wissen ist ein Strukturelement des Berufsethos von Handwerkerinnen und Handwerkern. Dabei ist das duale Ausbildungssystem ein ganz wichtiges Kennzeichen des Handwerks in Vorarlberg. Das Ländle gilt daher auf Bundesebene als führender Ausbildungsstandort. Das ist mit ein Grund, warum Vorarlberger Lehrlinge bei nationalen und internationalen Wettbewerben bis hin zu Weltmeisterschaften ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Der Erfolg geht quer durch alle Berufsgruppen und ist in der Langfristbetrachtung sehr konstant. Diese hohe Ausbildungsqualität ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Erzeugnisse der Vorarlberger Handwerksbetriebe auch ein Exportschlager sind und dass das Vorarlberger Handwerk und Gewerbe bundesweit den höchsten Exportanteil hat.
Derzeit läuft nicht alles rund . . .
Trotzdem bleibt auch das Gewerbe und Handwerk nicht von den aktuellen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen verschont. Laut Obmann Komm.-Rat Ing. Bernhard Feigl kämpft die Sparte derzeit in vielen Bereichen mit Umsatzrückgängen, fehlenden Aufträgen, hohen Belastungen und zahlreichen freien Stellen. Zwar gibt es in einigen Bereichen wieder Anzeichen für eine positive Entwicklung, aber für viele, vor allem im Investitionsgüterbereich, läuft es noch nicht rund. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat daher einen Plan entwickelt, der u. a. folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorsieht: Verbesserung der flächendeckenden Kinderbetreuung, Steuerbefreiung, Anreize für das Arbeiten über das Regelpensionsalter hinaus und Förderungen für die Qualifizierung im Bereich der Green Skills. Ernest F. Enzelsberger

Aus der Geschichte
Eine Käserei aus Hittisau für Schischkiwzi in der Ukraine.
Einen besonderen Exportauftrag wickelte die Hittisauer Schlosserei Eberle Metall Exclusiv, die „das gesamte Spektrum des ambitionierten Metallhandwerkes abdeckt“, 2003 in der Westukraine ab. Dabei ging es um die Planung und Errichtung einer Lehrkäserei in dem ukrainischen Ort Schischkiwzi mit 1800 Einwohnern. Das Kolchosendorf liegt 40 Kilometer entfernt von Czernowitz, der historischen Hauptstadt der Bukowina, die Teil der Habsburgermonarchie war.
Die Lehrkäserei zeigt der dortigen Bevölkerung neue Möglichkeiten der Produktion und Vermarktung ihrer Produkte auf und hatte ihren Ursprung in einer Idee von Ing. Anton Hagspiel. Dieser wollte ukrainischen Studenten, die bei ihrem Pflichtpraktikum in Vorarlberg die Vielfalt der Landwirtschaft bei uns kennenlernten, die Möglichkeit geben, ihr Wissen zum Wohle der landwirtschaftlichen Betriebe im eigenen Land umzusetzen. So konnte mit vielen Sponsoren eine Käserei errichtet werden, die Josef Eberle plante und in Hittisau vorfertigte. Die Bauteile wurden per Auto vom Bregenzerwald in das 2000 Kilometer entfernte Schischkiwzi transportiert, wo von Eberle und einem Mitarbeiter innerhalb einer Woche die Montagearbeiten durchgeführt wurden. „Das Projekt ist sehr erfolgreich und es ergaben sich viele freundschaftliche Kontakte zur ukrainischen Bevölkerung. In der Käserei wird Milch zu Joghurt und Rahm sowie Hart- und Schnittkäse verarbeitet. Das ist gerade in der Kriegszeit von großer Bedeutung“, erläutert Josef Eberle. Für sein Unternehmen spielt die Alpwirtschaft eine große Rolle, denn sie ist neben der Herstellung von Metallmöbeln sein Hauptgeschäft. Der von ihm 1985 übernommene Betrieb, in dem auch Sohn Lukas tätig ist, arbeitet mit modernster CNC-Technik. Die Mannschaft besteht aus drei Meistern, drei Gesellen, zwei Lehrlingen, einem geschützten Arbeitsplatz und einer Bürokraft. Die Ausbildung der Fachkräfte erfolgt in Eigenregie über den Weg einer Lehre.
Text: Ernest F. Enzelsberger
Fotos: Frederick Sams