Viel Neues an Wilhelm Tells Felsenufer
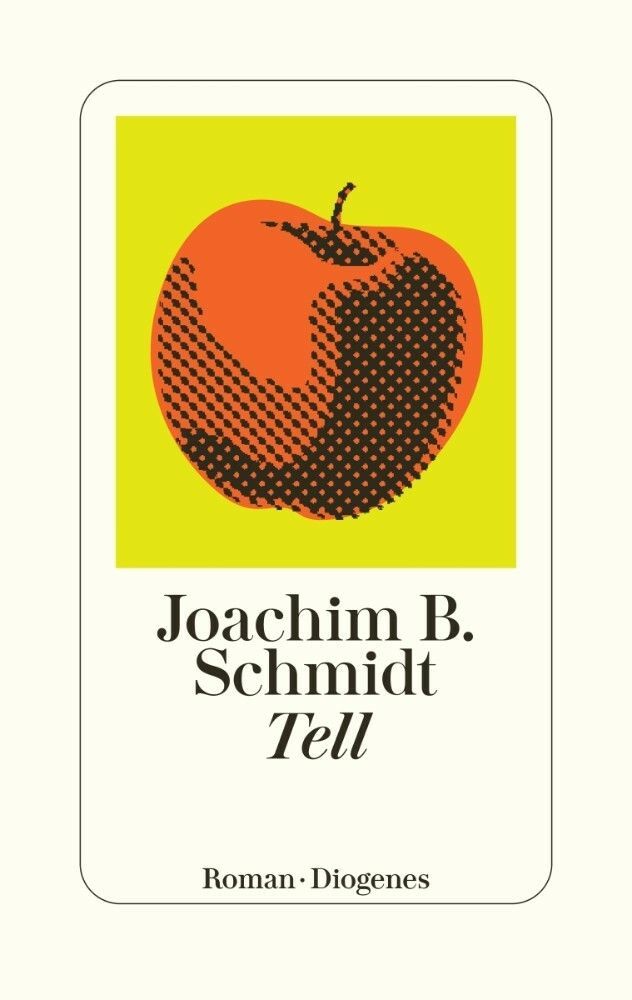
Tell
Joachim B. Schmidt
Diogenes
283 Seiten
Schillers Drama wird einmal völlig neu beleuchtet und dann geht es ins Pariser Kulturleben.
Romane Ganz entfernt vom Theaterstück beginnt dieses Buch mit einer Szene, in der ein Bär auf den Hinterpfoten steht und eine einsiedlerische Bauernfamilie mehr als nur interessant findet. Einer der Bauern steht mit der Armbrust zum Schuss bereit und eine Frau kommt aus der Hütte geeilt und verjagt den Bären mit einem Höllenlärm. Die Szene erlischt zwischen Erleichterung und Verärgerung und einer, nämlich Wilhelm, zieht mit Sohn Walter und Armbrust zornig in den Wald. Diese erste Szene kommt in Schillers „Wilhelm Tell“ so nicht vor und hätte Claus Peymann im Burgtheater die Inszenierung so eröffnet, hätten ihn die Boulevardmedien, bezüglich der gravierenden Textentfremdung, genüsslich zerrissen.
Heute freut man sich zum einen, dass ein relevanter Autor, in diesem Falle Joachim B. Schmidt, sich mit einem bildungsbürgerlichen Stück auseinandersetzt und zum anderen verweist man wohlgetrost auf die Serienästhetik der Streamingdienste. Das ist nicht so falsch: Schmidt arbeitet mit kurzweiligen Kapiteln, die jeweils von einem andern Protagonisten erzählt werden. Der Szenenmodus des Originals dürften Schmidt auch entgegengekommen sein. Jedoch, hinter dem Roman steckt ein großer dramaturgischer Aufwand, aber er hat sich gelohnt, die Geschichte fließt.
Tell wird erneut zum Kracher
Dazu wirft er ein anderes Licht auf die Tell-Familie: Fernab von ehrenhaften Eidgenossen rackern sich sehr verwegene Bauern in der Einöde ab und wildern was das Zeug hält. Zudem wirkt Tell verstört und verschlagen, begleitet von seinem ewigen Schatten, dem Bruder Peter, auf der Jagd verschollen zwischen unwegsamen Schluchten. Überall höllische Mikrodramen, die ans Herz gehen, als wäre man in der Soap gelandet, dazu wird geschlagen, gestohlen und gestorben. Das Setting ist schonungslos: Unterdrückte, aber aufmüpfige Bauern, unselige Soldaten und ein introvertierter, an Heimweh erkrankter Reichsvogt Hermann Gessler im Sold der Habsburger, der gegensätzlich zum Stück harmlos ist. Strippenzieher ist der wunderbar bösartig angelegte Harras, Gesslers Stallmeister, der bereits bei seinem ersten Auftritt eine Intrige verfolgt, so spielt sich der Autor gekonnt frei – viel Neues also am Felsenufer des Vierwaldstättersees, in der Beschreibung Schmidts ein absolut mystischer Wald. Eine Wiedergabe als Serie wäre nicht verwunderlich, der wirkliche Reiz wäre aber Schmidts „Tell“ auf die Bühne zurückzubringen, ein wahrer „Tell reloaded“.
Pariser Liebeleien
Paris verbunden mit Kunst, Kunstkritik und menschlichen Problemen ergeben eine schöne Regalreihe. Die französische Autorin Chloé Delaume fügt mit „Das synthetische Herz“ einen weiteren Roman hinzu. Ihre Heldin, Adélaides trennt sich von ihrem Mann, weil die Beziehung verödete. Zwischenmenschlich sollte es wieder knistern. Dazu ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit eines anerkannten Verlags zuständig und vertritt jede Saison vier Autoren.
Man kann sich fragen, ob das in Summe schon für einen Roman reicht. Ja und nein. Der französische Kulturbetrieb wird gekonnt seziert, es wird unappetitlich, sogar Aktionäre mischen mit. Die Beziehungsflaute ist mit schwarzem Humor getränkt, doch fehlt es hier an Tiefe und an der Seitenzahl. Martin Amis hat dafür in „Die Information“, einem ähnlich gelagerten Roman, an die 500 Seiten verbraucht. Eine greifbare Quintessenz hat eben ihren Preis.
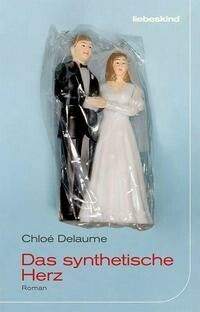
Das synthetische Herz
Chloé Delaume
Liebeskind
156 Seiten