Hommage an einen Film-Pabst
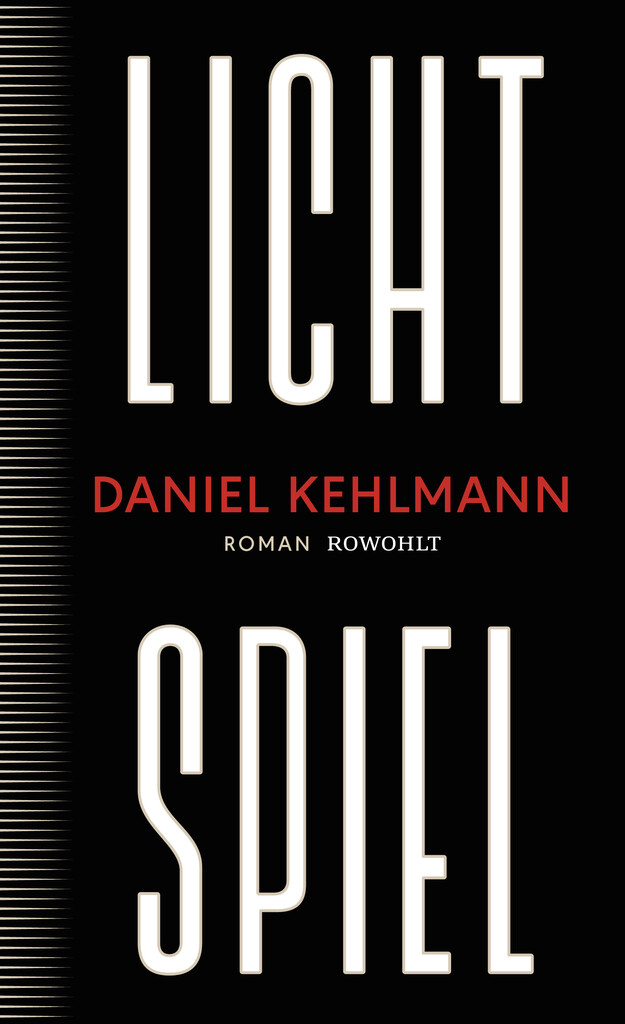
Lichtspiel
Daniel Kehlmann,
Rowohlt Buchverlag, 480 Seiten
Daniel Kehlmann widmet sich in seinem neuesten Werk „Lichtspiel“ dem Stummfilmregisseur Georg Wilhelm Pabst.
ROMAN Er hat Greta Garbo und Asta Nielsen für die Leinwand entdeckt und machte Schauspielerin Louise Brooks berühmt. Der in Böhmen geborene Georg Wilhelm Pabst – bekannt unter G. W. Pabst – war einer der renommiertesten Regisseure der Weimarer Republik. Filme wie „Die freudlose Gasse“ oder „Die Büchse der Pandora“ gelten als Meisterwerke der frühen Filmgeschichte. Nach der Machtergreifung der Nazis flieht Pabst in die USA, wo er in Hollywood auf eine glanzvolle Karriere hofft. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens verblasst sein Stern rasch. Pabst entschließt sich, nach Österreich zurückzukehren, passiert bei seiner Rückkehr unter anderem auch Feldkirch. So wie andere Größen der Zeit gerät er in die Fänge der Nationalsozialisten und muss erkennen, dass er sich dem Druck beugen muss, weil Hitler ihn unbedingt als Regisseur für den Film „Der Fall Molander“ haben wollte, in dem es um einen jungen Geigenspieler geht, der verhaftet wird, weil er falsch verdächtigt wird. Der abgedrehte Film –mit den Dreharbeiten wurde 1944 begonnen – wurde nie gezeigt und gilt heute als verschollen.
Bestsellerautor Daniel Kehlmann, der sich unter anderem schon mit Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt („Die Vermessung der Welt“) oder Till Eulenspiegel („Tyll“) literarisch auseinandersetzte, rückt in seinem neuesten Werk „Lichtspiel“ Georg Wilhelm Pabst in den Mittelpunkt. Freilich geht es nicht um eine fachlich aufbereitete Biografie, sondern um große Erzählkunst, die sich vor allem ab dem Zeitpunkt offenbart, an dem Pabst unfreiwillig mit dem Nazi-Regime in Kontakt gerät. Angekommen im steirischen Dorf Tilmitsch, erleidet der Regisseur einen Unfall, der ihn nicht mehr aus dem Dorf wegkommen lässt. Kehlmann begleitet seinen Protagonisten schriftstellerisch in seiner prägenden Phase, die ihn schmerzhaft erkennen lässt, dass auch die Kunst letztlich der Diktatur nicht entkommen kann. Kehlmann lässt seine Figur zwischen diesen Ambivalenzen schlingern, erklärt dabei sein Handeln aber plausibel, geht, um es in der Filmsprache auszudrücken, mit höchster Detailschärfe und zoomt die Gedanken des Regisseurs hautnah heran, baut aber auch Fiktionales ein. Der Roman liest sich wie eine surreale Groteske, in der es der Autor versteht, das Geschehene mit szenischen Schilderungen bis in den letzten Winkel auszuleuchten. Ein Roman über Kunst und Macht und den schönen Schein des Films. CRO