Die Zukunft der Südtirolersiedlung: Warum Gerold Strehle an Sanierung statt Neubau glaubt

Die Vogewosi denkt an, 80 Prozent der Bregenzer Südtirolersiedlung abzureißen. Der auf Sanierungen spezialisierte Architekt sieht weit mehr Möglichkeiten für den Altbestand.
Bregenz “Die beste Methode, Wohnraum zu schaffen, ist immer das Bestehende zum Erweitern, zum Adaptieren, zum Aufstocken”, ist Gerold Strehle überzeugt. Seit 2001 ist der Architekt im Hochbau rein im Sanierungsbereich tätig, unterrichtet an der Bau- wie auch an der Ziviltechnikerakademie Grundlagen der Sanierung.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.
Derzeit läuft der Ideenwettbewerb für die Zukunft der Südtirolersiedlung in der Landeshauptstadt, dieser soll zum Maßstab für die Sanierung aller vergleichbaren Siedlungen im Land werden. Und geht es nach Strehle, sind die Vorgaben alles andere als ideal. Der Eigentümer, die gemeinnützige Vogewosi, ist überzeugt, dass eine Sanierung für 80 Prozent der Gebäude der Siedlung weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist. Ein Versuch mit zwei Mustergebäuden in Bludenz gemeinsam mit den Energieinstitut zeigte zwar gute Ergebnisse, die derzeitige Förder- und Gesetzesstruktur mache es jedoch nicht sozialverträglich finanzierbar.
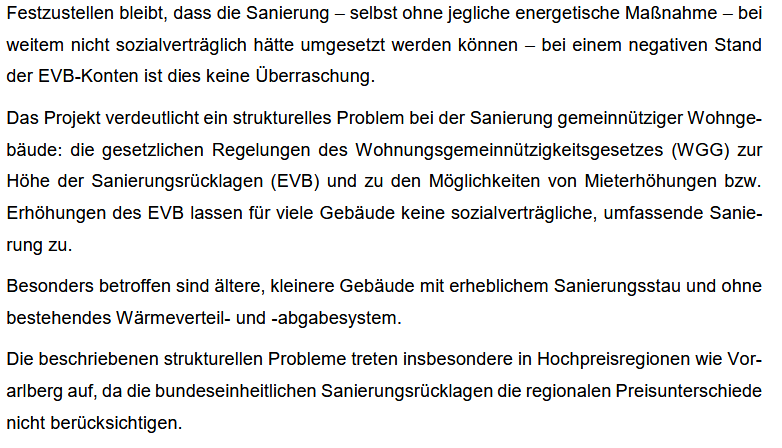
Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.
“Diese Form von Bausubstanz ist eine der dankbarsten zum Sanieren überhaupt”, sieht Strehle diese Einschätzung kritisch. Er selbst wohnt in einem sanierten Siedlerhaus von 1926, das aufgrund des Baujahres ähnliche Bautechniken aufweist. Die Südtirolersiedlungen haben noch weitere Vorteile: Alles vom Treppenhaus bis zur Fenstergröße ist standardisiert. “Vom Prinzip her sind dies Systemelemente”, vergleicht er es mit modernen Bautechniken. “Meine These ist, dass in Vorarlberg das entsprechende Wissen kaum vorhanden ist, weder bei Planern noch bei Bauträgern oder Genossenschaften.” Auch die Vogewosi hat bisher vor allem Neubauten schaffen müssen, statt die Siedlungen aus den 1930ern zu überarbeiten, entsprechendes Wissen war daher lange nicht gefragt. In anderen Bundesländern gibt es diese Erfahrungen aus Jahrzehnten der Sanierung und Adaption hingegen und wurden etwa vergangenes Jahr in der Energie Lounge und bei einer Tagung in Bregenz diskutiert.
Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.
“Die Einzigen, die ich in Vorarlberg kenne, die sich mit dem Thema Sanieren höchst professionell auseinandersetzen, sind die Sanierungslotsen“, verweist Strehle auf ein Angebot des Landes mit dem Energieinstitut zur Unterstützung bei der Sanierung von Altbestand. Während die öffentliche Hand hier den Erhalt von Wohnraum fördert, stellt man den Altbau der Südtirolersiedlungen allgemein infrage. Allein Oberösterreich liefere genug Beispiele, was stattdessen möglich wäre. Und wie Wohnen im Neubau ähnlich günstig möglich sein soll wie im sanierten Altbau, ist fraglich.
Hundertjährige Siedlung
Dass in den bald hundertjährigen Siedlungen Fragen der Barrierefreiheit und Wohnstandards zu stellen sind, ist auch Strehle bewusst. Er sieht vor den Häusern oft genug Platz für Rampen zu den Zugängen, die barrierefreie Erdgeschosse erlauben würden. Auch ließe sich mit geschickter Planung manche Treppenhäuser einsparen, um Wohnungen neu aufzuteilen. Selbst Maisonettewohnungen erlaube der Grundriss. Kleinere Wohnungen sind in einer Gesellschaft allein lebender Menschen, etwa nach Scheidungen, immer noch gefragt. Und die früher als Trockenraum genutzten Dachböden ließen sich zu Wohnraum aufstocken. Auf manchen der großzügigen Grünflächen, deren Funktion als Geselligkeitsraum etwas überholt ist, kann durchaus in ökologischer Bauweise nachverdichtet werden oder neue Räume der Gemeinschaft und Geschäftsflächen entstehen. Da man nicht jede Mauer neu bauen müsse, wären die Sanierung und Aufstockung quasi automatisch günstiger als der Neubau und damit im Sinne des Steuerzahlers, der Nachhaltigkeit und der Verhinderung zusätzlicher Bodenversiegelung.
Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.
“Das Spannende an dieser Siedlung wäre ein Bilderbuch an typologischen Formen, was alles da drinnen möglich wäre”, hofft Strehle auf eine Sammlung von Vorschlägen an Wohnformen und Gebäudestrukturen als Ergebnis des Ideenwettbewerbs. Auch Kooperationen mit Baugruppen, die in sanierten Objekten neue Konzepte des Wohnens testen wollen, wären denkbar. Ein Abriss von 80 Prozent der Gebäude sei jedoch eine Auslöschung wertvoller Baukultur und Gesellschaftsgeschichte. Und wenn es wirklich die Blaupause für die Sanierung aller Südtirolersiedlungen wird, gilt dies nicht nur für Bregenz.