Es ist alles eine Frage der richtigen Wortwahl

Worte machen Politik: Expertin Wehling erklärt, wie „politisches Framing“ funktioniert.
Schwarzach. In Wahlkampfzeiten überbieten sich politische Parteien mit Vorschlägen, wie und in welcher Größenordnung die Steuern gesenkt werden sollen. Sie wollen „entlasten“, wollen „befreien“, wollen „erleichtern“, ja sogar „entfesseln“. Steuern sind eine Last (Steuerlast), eine Bürde. Diese Ausdrücke haben sich längst in der Sprache etabliert. Wir nehmen sie hin, denken nicht weiter darüber nach. Das sollten wir aber, erklärt Elisabeth Wehling. Sie ist eine deutsche Linguistin und forscht an der Universität von Kalifornien. Sie veröffentlichte im Februar dieses Jahres ein Buch mit dem Titel „Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht“ und war kürzlich auf Einladung der Grünen in Vorarlberg zu Gast.
Oasen versus Wüste
Als „sprachliche Frames“ sind gedankliche Deutungsrahmen zu verstehen, die jeder verwendet und die je nach Wertevorstellung variieren. „Zudem sind politische Frames immer ideologisch selektiv“, erläutert Wehling. Selektiv heißt: Ein Frame beleuchtet nicht das ganze Thema, es schließt gewisse Gesichtspunkte aus. Bleiben wir beim Beispiel „Steuern“. Länder mit einer niedrigen Steuerquote werden als „Paradies“ oder „Oase“ bezeichnet. Eine Oase ist der Ort, an dem es Wasser gibt, der das Überleben sichert. Um eine Oase herum befindet sich die Wüste. Auch der Jagdjargon wird strapaziert: Die Millionärssteuer trifft den Vermögenden. Wie eine Kugel aus einer Pistole. In ihrem Buch schreibt Wehling: „Die Idee, dass Steuern eine soziale Überzeugungstat sind, dass man sie gerne beiträgt und stolz darauf ist, findet sprachlich in unseren Debatten nicht statt.“ Und das sei gefährlich, denn sie ist sich sicher: Entscheidungen werden auf Basis von Frames getroffen, nicht faktenbasiert.
Was Sozialhilfe bedeutet
Frames können sich mit der Zeit verändern. Wehling beschreibt das Wort „Sozialhilfe“: „Es geht um das Helfen aus einer sozialen Verantwortung heraus. Allerdings wird das Wort ‚sozial‘ zunehmend nicht mit wohlwollendem, an die Gruppe gerichteten Handeln assoziiert, sondern mehr und mehr mit den Menschen, denen dieses Handeln zugute kommt.“ Der Ausdruck „Mindestsicherung“ sei eine gute Alternative.
Auch die Lohndebatte sei von Frames geprägt. Zum Beispiel die Begriffe „geringes Einkommen“ oder „Geringverdiener“. Wehling analysiert: „Diese Begriffe machen die Frage der Entlohnung zu einer Angelegenheit des Arbeitnehmers, nicht des Arbeitgebers.“ Wer sich für höheren Lohn einsetze, solle lieber von „geringer Entlohnung“ und „Geringentlohnern“ sprechen. Auch das Wort Klimawandel würde nicht ausdrücken, was gemeint ist. Schließlich könne sich etwas zum Schlechten oder zum Guten wandeln. „Wer sich ernsthaft um das Klima sorgt, für den wäre schon mit dem Wort ‚Klimaverschlechterung‘ viel geschafft“, rät die Expertin.
Der Begriff „Asylant“ ist aus politischen Debatten fast gänzlich verschwunden, sein abfälliger Beiklang ist allgemein anerkannt. Stattdessen wird mit dem Ausdruck „Asylwerber“ gearbeitet. Doch Wehling gibt zu bedenken: „Dieses Wort hebt die administrative Arbeit und die Behördengänge hervor. Wer gedanklich die Ursache für die Anreise und die Hoffnung auf Schutz profilieren möchte, spricht besser von Asyl- oder Schutzsuchenden.“
Auch nicht verneinen
Politische Frames prägen sich auch ein, wenn sie verneint werden – es reicht die bloße Verwendung. Wenn ein Politiker ein Framing übernimmt, um etwas zu dementieren, habe er schon verloren. Schließlich übernehme er die Weltsicht des Gegners und vergesse darauf, seine eigene zu propagieren. Wehling erklärt das anhand einer Diskussion zwischen einem jungen Mann, der sich für großzügig hält, und seiner Mutter, die meint, er wäre verschwenderisch. Sobald der Mann sagt: „Nein, ich bin nicht verschwenderisch“, bewege er sich im Frame der Mutter. Das Wort „großzügig“ sei damit aus der Debatte verschwunden.
Phobie macht bedrohlich
Beim Massaker in einem Homosexuellenklub in Orlando sei in den Analysen von „Homophobie“ die Rede gewesen. „Phobie“ bezeichnet eine übersteigerte Reaktion auf einen Angsttrigger, zum Beispiel bei der Spinnenphobie. Spinnen werden als bedrohlich dargestellt, was beim aktivierten Frame auch mit Homosexuellen passiert. „Wer sich für den Schutz von Homosexuellen gegen hetzende und gewalttätige Mitbürger einsetzt, sollte den Frame nicht nutzen. Das gilt auch für die Islamophobie“, erläutert Wehling.
Um dem Framing auf die Spur zu kommen, rät Elisabeth Wehling: „Man muss sich in das Thema einlesen, dann wird man wacher für die Frames, die Debatten bieten. Und man sollte bei der Zeitungslektüre innehalten und kritisch fragen, was alles in Schlagworten steckt.“ Und vielleicht einmal von „Steuerbeitragern“ statt „Steuerzahlern“ sprechen.
Die Idee, dass man mit Steuern etwas beiträgt, findet so nicht statt.
Elisabeth Wehling
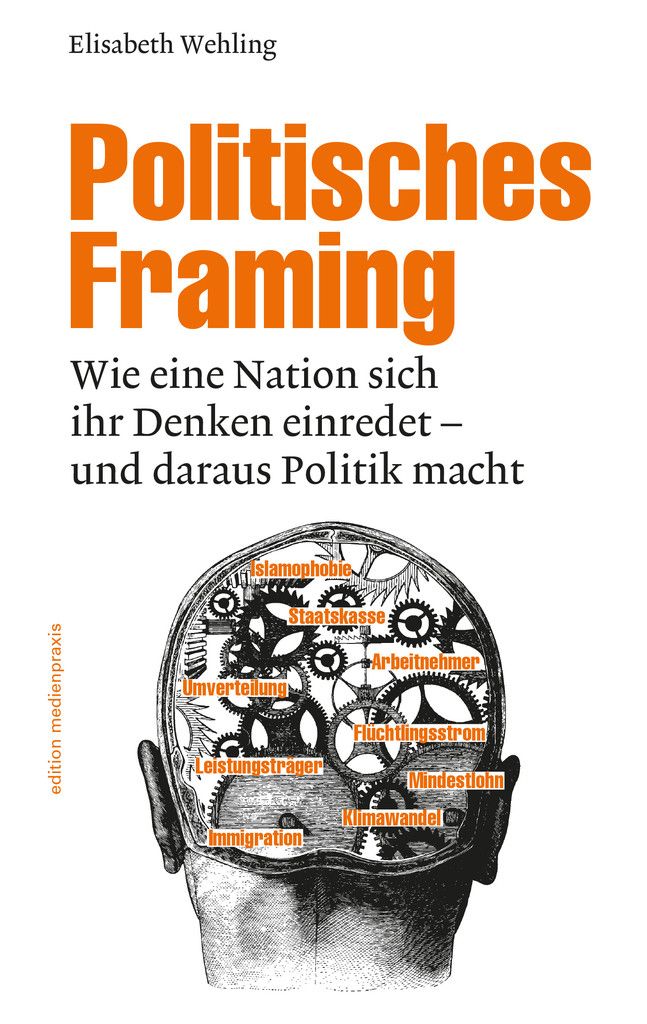
Elisabeth Wehling: „Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht“. edition medienpraxis, 2016. ISBN: 978-3-86962-208-8