Herumgemosert: Religion, Ethik und Unterricht
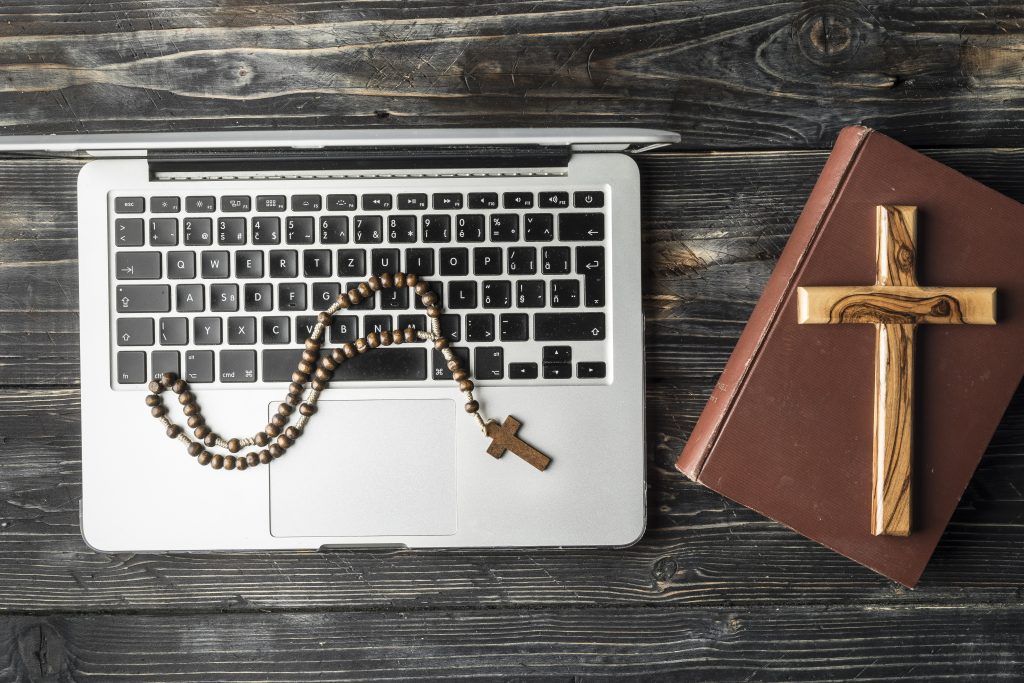
Die Diskussion um Religions- und Ethikunterricht begleitet uns nun schon seit einigen Jahren und hat nun endlich in die Einführung des letzteren gemündet. Damit ist die Diskussion um den Religionsunterricht freilich noch nicht beendet. Kritiker fordern einen Ethikunterricht für alle und Religion als Freifach. Dem stehen allerdings nicht nur politische, sondern auch völkerrechtliche Probleme entgegen.
Österreich hat dem Heiligen Stuhl im Konkordat von 1934, einem Vermächtnis des Dollfuß-Regimes, nämlich garantiert, den Religionsunterricht „im bisherigen Ausmaß“ weiterzuführen. Und auch eine neuere Vereinbarung aus dem Jahr 1962 hält fest: „Eine Neufestsetzung des Stundenausmaßes wird zwischen der Kirche und dem Staate einvernehmlich erfolgen.“ Daraus ergibt sich die eher absurde Situation, dass eine Kürzung der Religionsstunden nur möglich ist, wenn Österreich aus einem Staatsvertrag aussteigt oder mit dem Vatikan eine Änderung vereinbart. Gleiches gilt für den Umstand, dass die Religionslehrer von der Kirche bestellt aber von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Da man die übrigen Religionsgemeinschaften nicht diskriminieren kann, gilt für sie dasselbe Recht wie für die katholische Kirche.
Ideologische Tretmine
Dass der Religionsunterricht schon immer eine ideologische Tretmine war, verwundert wenig. In seiner gegenwärtigen Form stellt er das Überbleibsel an kirchlicher Autorität in der Schule dar, das ihr nach einem jahrhundertelangen Verdrängungsprozess geblieben ist. Dass man ihr nach und nach die Kompetenz für die Schulen entzog, hatte dabei durchaus seine Gründe. Der Fürsterzbischof von Olmütz hatte etwa die Lehrer 1831 angewiesen das „Lesen und Kopfrechnen als Nebengeschäft“ zu verstehen. Das Schreiben sollte man den Schülern sowieso nur „in der vom Religionsunterricht erübrigten Zeit“ und „nur auf besonderes Verlangen der Eltern und zwar in Extrastunden“ beibringen. Lange noch blieb Religion an den österreichischen Schulen der wichtigste Gegenstand. Als liberale Politiker 1906 das Schulgebet und die Schulmesse infrage stellten, empörten sich die österreichischen Bischöfe in einem Hirtenbrief: „Man will den Religionsunterricht und die Anleitung zum religiösen Leben aus der Schule verweisen und den Religionsunterricht höchstens durch eine farb- und kraftlose Sittenlehre ersetzen.“
Die damalige Angst der Bischöfe, man wolle „alle Erinnerungszeichen der Religion“ aus der Schule entfernen, hat sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Österreichs Vertrag mit dem Heiligen Stuhl schreibt schließlich immer noch vor, dass in Klassen, in denen „die Mehrzahl der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehört, ein Kreuz angebracht wird“.