Eine Intensivstation ist keine Einbahnstraße
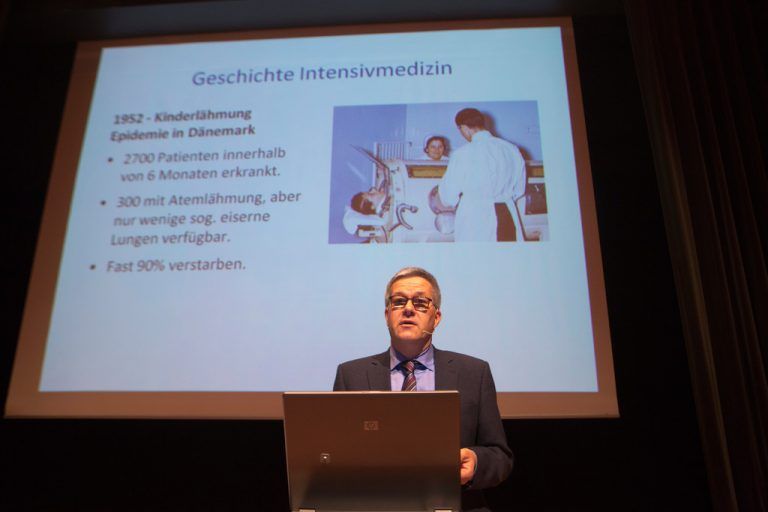
Denn bei vielen Patienten steht eigentlich die Überwachung im Vordergrund.
Wolfurt. (VN-mm) Am Anfang stand eine scheinbar unüberwindbare Schlucht, am Ende ein Weg, der in lichte Höhen führte: Die Bilder, mit denen Primar Guntram Winder die Besucher des Mini Med Studiums auf einer „Wanderung“ durch die Intensivstation begleitete, hatten starken Symbolcharakter. Eine Intensivbehandlung kann nämlich auch wieder zurück in ein gutes Leben führen. Was sie in den meisten Fällen tut.
Im Krankenhaus Dornbirn etwa liegt die Sterblichkeit zwischen 5 und 15 Prozent. „Die meisten Patienten überleben die Intensivstation“, lautete also die gute Nachricht von Primar Harald Sparr, Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin im KH Dornbirn, an die Zuhörer.
Hohe Erwartungen
Bedeutet Intensivmedizin Lebensrettung oder Leidensverlängerung? Um diese ebenso spannende wie berührende Frage drehte sich alles beim Mini Med Studium im Wolfurter Cubus. Für Harald Sparr ist die Beantwortung beinahe tägliches Brot. Es sei oft schwierig, Angehörigen die Grenzen zu erklären, auch aufgrund der hohen Erwartungen, die in diese Art der Behandlung gesetzt würden. Er selbst sieht die Grenzen dort, wo wichtige Organe versagen oder es zu einer Blutvergiftung (Sepsis) kommt. „Die Sepsis ist eine Volkskrankheit mit tödlichen Folgen, wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt wird“, klärte der Intensivmediziner das Publikum auf. Und sie kommt oft vor, fast genauso oft wie Krebs. Nur werde die Sepsis zu wenig wahrgenommen. So sind 40 Prozent der Sterbefälle auf Intensivstationen einer Blutvergiftung geschuldet. Gefährdet sind laut Sparr vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Säuglinge und Kinder, chronisch Kranke und Patienten nach einer Notfall-Operation.
Abgestuftes Intensivkonzept
Insgesamt verfüge Vorarlberg über ein gut abgestuftes Intensivkonzept. Gleichzeitig ließ Sparr anklingen, dass der Bedarf an Intensivbetten größer wird. Ursache ist die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung. Bereits jetzt sind im KH Dornbirn ein Viertel aller chirurgischen Patienten, die auf die Intensivstation müssen, älter als 65 Jahre. Bei ihnen ist die Gefahr von Komplikationen höher, weshalb sie zur Überwachung häufig auf die Intensivstation gebracht werden. „Die Überwachung steht bei vielen Patienten im Vordergrund“, unterstrich Harald Sparr.
Die Aufgaben der Intensivmedizin skizzierte er folgendermaßen: Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von lebensbedrohlichen Erkrankungen. Dazu braucht es eine spezielle Station sowie entsprechend ausgebildetes Fachpersonal. Verschiedene Disziplinen spielen hier zum Wohle des Patienten zusammen. Je nach Behandlungsstufe stehen pro Bett 1 bis 3 Fachkräfte zur Verfügung. Das Problem: Sie sind immer schwerer zu finden. Es gibt 78 Intensivbetten im Land, die meisten davon im LKH Feldkirch. Das KH Dornbirn verfügt über acht Intensiv- und drei Intensiv-Überwachungsbetten sowie eine Überwachungseinheit für Neugeborene mit sechs Betten.
Frühzeitige Mobilisation
Eine gute Untersuchung, das Ausschalten vorhandener Risikofaktoren sowie die richtige Wahl des Narkoseverfahrens sind laut Primar Harald Sparr wichtige Kriterien zur Vermeidung möglicher Komplikationen während eines Aufenthalts auf der Intensivstation. Auch die frühzeitige Mobilisation eines Intensivpatienten durch das Pflegepersonal zählt zu den entscheidenden Dingen. Denn sie signalisiert: „Es geht aufwärts.“ Und das trage wesentlich zu einer rascheren Genesung bei.
Es ist oft schwierig, Angehörigen die Grenzen zu erkläten. Die Erwartungen sind hoch gesteckt.
harald sparr
