Von Menschen, die nicht klarkommen
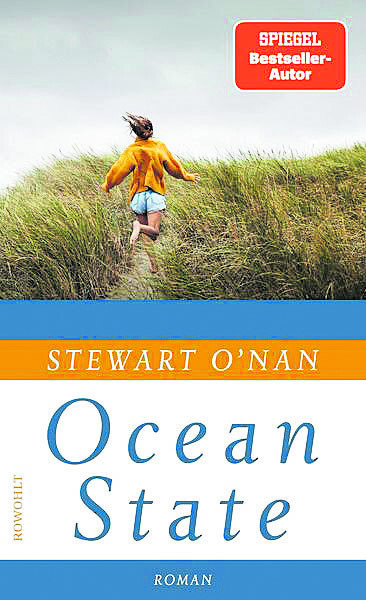
Ocean State
Stewart O’Nan
Rowohlt
253 Seiten
Punkrocker erzählen und Stewart O’Nan schließt bei seinen Anfängen an und begleitet seine jugendlichen Protagnisten.
Romane Die New-England-Staaten in den USA sind vor allem für ihre einladenden Küstenlandschaften, für Ferienhäuser gut situierter New Yorker Familien, für ihre Lobster, für Segelbote und gelegentlich auch für Bestseller bekannt. Stephen Kings „Es“ spielt beispielsweise in einer fiktiven Kleinstadt in Main mit bunten Häusern, in den 1950er-Jahren. Gute 70 Jahre später legt nun Stewart O’Nan seinen Roman „Ocean State“ vor, er spielt in Westerly, einer unbedeutenden Küstenstadt der Neuengland-Staaten. Aus diesem Sumpf läuft man fort und macht Karriere oder man verschläft den Absprung und muss sich so durchs Leben schlagen, wie in „Ocean State“. O’Nans Protagonisten sind zum Großteil jung. Wenn man nicht wissen würde, dass die Story in einer Katastrophe endet – ein Mädchen tötet ein anders aufgrund eines Beziehungsstreits – wäre es eher eine soziologische Bestandaufnahme. Doch so weiß der Leser, wohin die Reise geht und Stewart O’Nan erzeugt einmal mehr einen unheimlichen Sog.
Im Grunde ist es eine Rückkehr zu seinem zentralen Werk: Für „Engel im Schnee“ bekam er 1993 den William-Faulkner-Preis und es folgten darauf die Romane „Die Speed Queen“ und „Halloween“, mit einem überstrahlenden Leitthema: Junge Menschen, die nicht mit ihrem Leben klarkommen. Sie leben ein Leben zwischen Depression und Sehnsucht. Doch der Autor bleibt im seriösen Bereich, ganz ohne Sozialporno begleitet er seine Charaktere auf dem Weg in die Katastrophe, wie ein Analytiker, der nicht eingreift, sondern berichtet. Als wären seine Figuren in einer Art Dämmerzustand, sind sie unterschwellig von einem strengen Calvinismus gelenkt. Die Menschen gehen – fast schon provozierend freiwillig – in ihr „gottgewolltes“ Unglück und keiner kann sie davon abhalten. Der Sog wird zum einen durch das drohende Unglück erzeugt, zum anderen durch den klugen Mix an verteilten Rollen. Einen Unterschied zu den Vorgängern gibt es, die Story wird ausnahmslos aus der Sicht der Frauen in dem Roman erzählt: Birdy und Angel rittern um Myles, den jungen Mann mit dem Haus am Meer, während Angels Mutter durchs Leben stolpert und die jüngere Schwester Marie ist mehr oder minder die Chronistin der Ereignisse. Daraus entwickelt sich ein spannendes Buch.
Eine Band mit Biss
Biografien sind eine schwierige Angelegenheit. Entweder loben sie den Beschriebenen über den grünen Klee oder sie vernichten ihn. Interessant ist, wenn sich aus einer Biografie ein spannendes Zeitdokument entwickelt: Nach Jahren neu aufgelegt wurde „The Clash“, das offizielle Bandbuch einer der wichtigsten Punkrocker der 1970er-Jahre. The Clash waren eine Art Farbklecks in einer ziemlich grauen Zeit. Sie waren Kunststudenten, die ihr Studium abbrachen, um Musik zu machen und mussten illustren Jobs nachgehen, wie verdächtige Briefsendungen öffnen, in denen IRA-Briefbomben vermutet wurden.
Sehr cool ist, dass die damaligen Musiker ihre subjektive Sicht der Dinge erzählen, über die Band, über Erfolg und Misserfolg. Die Dialoge sind gut montiert, sodass ein fast natürlicher Drive entsteht. Man darf nicht vergessen, die Band spielte 1976 in Hinterzimmern, aber die Jungs hielten zusammen. Acht Jahre später füllte man Stadien in den USA und war heillos zerstritten. Das Buch endet mit der Trennung der Band. Um sich selbst zu finden, ging der Leadsänger Joe Strummer wieder in Fußgängerzonen und spielte einfach darauf los. Das hat Stil.
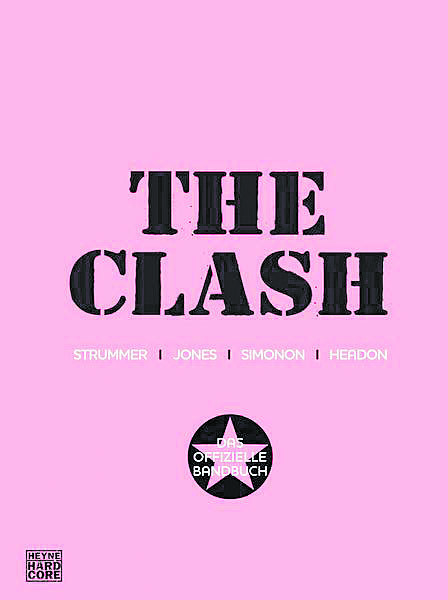
The Clash
Das offizielle Bandbuch
Heyne
408 Seiten