Armut ist auch in Vorarlberg weiblich

So lautete der Schwerpunkt der heutigen Pressekonferenz der Caritas im Lerncafé Feldkirch.
FELDKIRCH Die Caritas hat eine Inlandskampagne vorgestellt, die sich der Armut von Frauen und deren Auswirkungen auf Kinder widmet. Caritasdirektor Walter Schmolly erläuterte, dass trotz einer allgemeinen Erholung von den sozialen Krisenfolgen eine spezifische Gruppe, insbesondere Frauen und Alleinerziehende, erhebliche Entbehrungen erleiden. “Ein großer Teil der Bevölkerung hat sich von den Krisen erholt, aber es gibt eine kleinere Gruppe, die weiterhin mit schweren sozialen Folgen zu kämpfen hat”, so Schmolly.

Frauenarmut trifft Kinder doppelt
Denise Zech, Koordinatorin des Lerncafés in Bludenz, sprach über die Belastungen, die Kinder aus von Armut betroffenen Familien tragen müssen. „Oft übernehmen vor allem Mädchen viel Verantwortung. Sie kümmern sich um jüngere Geschwister und unterstützen den Haushalt, während ihre Mütter arbeiten oder sich weiterbilden“, so Zech. Diese Überlastung führe dazu, dass die Bildungs- und Entwicklungschancen dieser Kinder stark beeinträchtigt werden.

Auch die Notschlafstellen der Caritas sind ein Schwerpunkt der Kampagne. „Frauen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, nehmen häufig viel auf sich, um nicht auf der Straße leben zu müssen. Sie meiden aus Scham und Stigma Einrichtungen wie unsere“, erklärte die Leiterin der Notschlafstelle Feldkirch, Alexandra Achatz und fügte hinzu: “Sie kommen bei Bekannten unter, ertragen häusliche Gewalt und geraten in Abhängigkeitsbeziehungen.” Im vergangenen Jahr bot die Notschlafstelle 195 Menschen vorübergehend Unterkunft und verzeichnete insgesamt 1536 Nächtigungen. Mit 27 Frauen bleibt der Anteil weiblicher Gäste jedoch gering.

Maßnahmen im Fokus
Zur Bekämpfung der Frauenarmut und deren Auswirkungen auf Kinder stellte Walter Schmolly vier zentrale Maßnahmen vor: die Stärkung sozialer Unterstützungsleistungen, das Schließen des Gender-Care-Gaps, die Erhöhung der Ausgleichszulage und die Förderung der Chancengerechtigkeit für Kinder.
Laut der Caritas muss das Ziel der Regierungen auf Bundes- und Landesebene sein, Armut in der Gesellschaft und damit insbesondere auch Frauen- und Kinderarmut zu vermeiden. „Längerfristig ist ein solcher Sozialstaat eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft”, ist Walter Schmolly überzeugt und fordert, dass der Budgetdruck nicht zu Einsparungen zulasten sozialer Aufgaben führen darf.
Des Weiteren wird der Gender-Care-Gap adressiert, der durch die überproportionale Übernahme unbezahlter Pflege- und Betreuungsarbeit durch Frauen entsteht und diese finanziell benachteiligt. Im Schnitt verdienen Frauen in Vorarlberg 23,4 Prozent weniger als Männer – der Gehaltsunterschied entsteht oft mit dem ersten Kind, wenn Frauen deutlich mehr Care-Arbeit übernehmen. Zwischen 25 und 39 leisten Frauen doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit, was langfristig zu verwehrten beruflichen Chancen, niedrigen Pensionen und einer hohen Armutsgefährdung führt.
Eine weitere wesentliche Maßnahme wäre die Anhebung der Ausgleichszulage. Diese liegt laut der Caritas mit aktuell 1421 Euro monatlich um 151 Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle. Eine Erhöhung würde den Mindestpensionistinnen und allen Bezieherinnen von Sozialleistungen, die an die Ausgleichszulage gekoppelt sind, zugutekommen. Zusätzlich sollten die Anstrengungen in Bildungsinitiativen wie beispielsweise den Lerncafés, die darauf abzielen, Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen bessere Zukunftschancen zu ermöglichen, verstärkt werden.
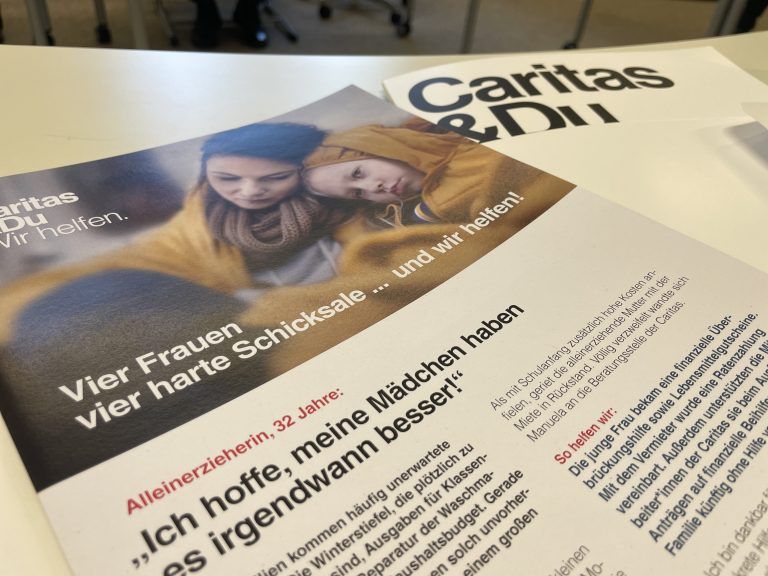
Zahlen stark gestiegen
In den ersten drei Quartalen dieses Jahres stieg die Zahl der Menschen, die über die Caritas-Beratungsstellen Unterstützung erhalten haben, im Vergleich zum Vorjahr, um 17 Prozent auf insgesamt 5.986 Personen. Besonders alarmierend ist der Anstieg bei den betroffenen Kindern: Mittlerweile sind 2.279 Kinder auf Unterstützung angewiesen, eine Erhöhung um 25 Prozent. Somit sind 38 Prozent der Klienten der Caritas-Beratungsstellen für “Existenz&Wohnen” minderjährig. Auch alleinerziehende Haushalte sind überproportional betroffen. 35 Prozent der Familien mit Kindern, die in den Beratungsstellen Hilfe bekommen, bestehen aus alleinerziehenden Elternteilen – zum weit überwiegenden Teil Frauen.