Ewige Baustelle Schule
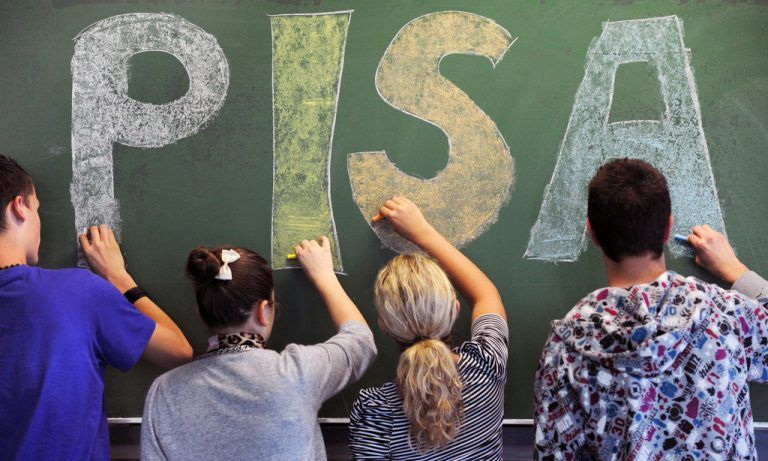
Einmal mehr hat ein PISA-Test das Bildungsdilemma im Land offengelegt.
Schwarzach. Peter Fischer (65) von der ARGE Gemeinsame Schule, Rainer Gögele (60) von „Pro Gymnasium“, Arbeiterkammer-Bildungssprecher Gerhard Ouschan (56) und Christoph Jenny (51), Bildungsexperte der Wirtschaftskammer, mit ihren Ideen zur Beendigung der Bildungsmisere.
Wie aussagekräftig ist die PISA-Studie?
Fischer: Wie bei allen empirischen Studien gibt es auch bei PISA Schwachstellen. Letztlich geht es um die Überprüfung von berufs- bzw. lebensrelevanten Kompetenzen von Schülern einer vergleichbaren Altersgruppe. PISA gibt es seit 2000. Mit den ersten Ergebnissen der Studie wurde damals der Mythos von den guten Schulsystemen in Deutschland und Österreich radikal widerlegt.
Gögele: PISA ist nur sehr eingeschränkt aussagekräftig. Wesentliche Punkte, wie sprachliches Ausdrucksvermögen, literarisches Verständnis, fremdsprachliches Können und Allgemeinbildung insgesamt, spielen darin keine Rolle.
Ouschan: Die PISA-Tests sind ein Instrument von vielen, um die Leistungsfähigkeit eines Schulsystems in ein Ranking zu fassen. Das Interesse liegt in der Frage „Was können Schüler?“ und nicht in der wichtigeren Frage „Warum können sie es (nicht)?“. Einige Länder haben sich seit 2000 erfolgreich auf den Weg gemacht.
Jenny: Die PISA-Ergebnisse zeigen vor allem eines: Österreich kommt in der Bildung schon seit Jahren nicht vom Fleck, und das, obwohl immer wieder zusätzlich Gelder in die Hand genommen werden. Das sollte uns zu denken geben.
Wie kann man die Zahl der Risikoschüler reduzieren?
Fischer: Durch eine fundierte Ausbildung von Kindergartenpädagogen an der PH Vorarlberg, durch zusätzliches Unterstützungspersonal, durch ganztägig verschränkte Schulformen, durch ein jahrgangsübergreifendes und inklusives Schulsystem, das Kinder nicht willkürlich trennt.
Gögele: Durch gezielte Frühförderung. Niemand darf in die Volksschule, der nicht Deutsch kann. In der Volksschule muss dann intensiv trainiert werden. Dazu braucht es zwei Lehrer pro Klasse. Niemand darf die Volksschule verlassen, der nicht lesen, schreiben und rechnen kann.
Ouschan: Durch mehr individualisierten Unterricht und Förderung, durch pädagogische Autonomie. Schüler müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen. Man muss auf die unterschiedlichen Lerntempi eingehen – und auch auf die unterschiedlichen Talente.
Jenny: Durch einen Unterricht, in dem nicht der Lehrer im Mittelpunkt steht, sondern die Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Potenzialen. Neben neuen Unterrichtsformen brauchen wir Pädagogen, die für Erfolg oder Misserfolg ihrer Schüler Verantwortung übernehmen.
Wie kann man die Zahl der Spitzenschüler erhöhen?
Fischer: Jedenfalls nicht durch Sonderklassen oder Sonderschulen, sondern durch sensible Pädagogen, die in heterogenen Klassen die Stärken und Defizite ihrer Schüler erkennen und darauf mit differenzierten Maßnahmen reagieren. Das Fördern funktioniert auch in heterogenen Klassen.
Gögele: Man muss – wie in Oberösterreich – gezielte Begabtenförderung betreiben. Dort haben die Schulen ihre Hochbegabten zu melden. Diese werden getestet und anspruchsvollen Förderwochen zugeführt. In Oberösterreich sind das 2000 Schüler – von der Volksschule bis zur Maturaklasse.
Ouschan: Durch geeignete und qualitativ anspruchsvolle Individualförderung. Erfolgreiche Länder bieten Angebote, die über den Lehrplan hinausgehen, oder ermöglichen Schülern vorzeitig den Besuch höherer Klassen. Gefragt ist Binnendifferenzierung, die auf hoher Autonomie aufbauen kann.
Jenny: Es braucht eine Schule mit einem innovativen Unterricht und der richtigen Haltung, die die Schüler in den Mittelpunkt stellt und die Eltern aktiv mit einbindet. Damit wird gemeinsam ein positives Lernumfeld geschaffen. In einer solchen Schule wird die Zahl der Spitzenschüler steigen.
Welche Maßnahmen sollte man setzen, um Mädchen an das Leistungsniveau der Burschen auf möglichst hohem Level heranzuführen?
Fischer: Der Gender-Gap ist ein gesellschaftliches Problem und spiegelt sich in der Schule wider. Dieses Problem wird wohl noch viele Generationen andauern. Die einzige Chance zur Lösung sehe ich durch die Minimierung von geschlechterspezifischen Unterschieden in den verschiedensten Bildungseinrichtungen.
Gögele: Meine Erfahrung als Lehrer ist eine andere. Mädchen haben deutlich bessere Noten als Burschen. Man muss sich dieses Detailergebnis genau anschauen. Ich weiß kein Patentrezept in dieser Frage. Es gibt typische Stärken: Mädchen bei Sprachen, Burschen in den Naturwissenschaften.
Ouschan: Es muss das Angebot an hochwertigem naturwissenschaftlichem Unterricht in den unteren Jahrgangsstufen ausgebaut werden. Geschlechterspezifische Stereotypen in Bezug auf naturwissenschaftsbezogene Berufe kann man im Unterricht kreativ hinterfragen.
Jenny: Schulische Erfolge werden maßgeblich von gesellschaftlichen Bildern geprägt. Mädchen oder Jungs bestimmte Interessen oder Fähigkeiten von vornherein abzusprechen, fördert Bildungserfolge nicht, das Wecken von Begeisterung als Triebfeder für den Lernerfolg dagegen schon.