„Reise ist noch nicht zu Ende“
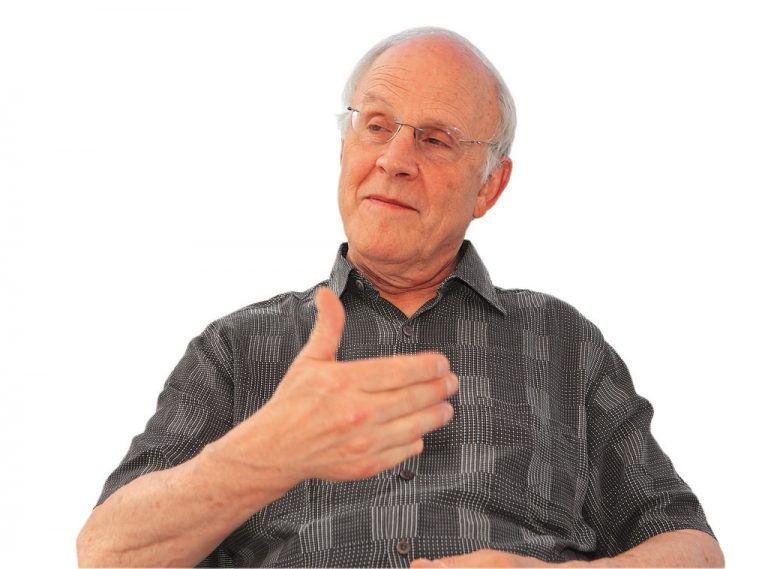
David Gross lüftete ein Geheimnis über die kleinsten Bausteine der Materie.
Lochau. Er wird vor ausgewähltem Publikum heute im Festspielhaus einen Einblick in die faszinierende Welt der theoretischen Physik geben. Er ist einer der großen Wissenschaftsstars unserer Zeit und gewann 2004 den Physik-Nobelpreis: David Jonathan Gross, US-Amerikaner mit jüdischen Wurzeln. Im VN-Interview spricht Gross über seine Arbeit, das Forschungsprojekt CERN, den Unterschied zwischen theoretischer und experimentellen Physik sowie seine Beziehung zu Österreich.
Viele Menschen träumen davon, einmal einen Nobelpreis zu bekommen. Wie hat diese große Auszeichnung ihr Leben verändert?
David Gross: Der Nobelpreis hat mein Leben natürlich verändert. Nicht nur positiv. Für wissenschaftliche Tätigkeiten bleibt nicht immer genügend Zeit. Es lauern Versuchungen – mal hierhin, mal dorthin zu reisen. Aber klar: Es haben sich auch neue Möglichkeiten eröffnet. Man kann helfen, der Preis öffnet Türen. Und ich genieße es selbstverständlich auch.
Wie haben Sie Ihr Interesse für Physik entdeckt?
Gross: Das Interesse kam schon in meiner Bubenzeit. Mich hat die Welt der Physik sofort fasziniert. Ich las populärwissenschaftliche Bücher über Einstein und andere Wissenschaftler. Ich war gut in Mathematik, habe gerne mathematische Rätsel gelöst. Aber die Physik erschien mir aufregender, weil es da mehr um die wirkliche Welt geht. Der Entschluss, theoretischer Physiker zu werden, kam früh. Ich habe Physik studiert und versucht, die fundamentalen Gesetze der Natur und des Universums zu verstehen, genauso wie sehr komplizierte andere Phänomene. Ich hatte und habe natürlich auch das Glück, in einer Zeit zu leben, in der Physik einen hohen Stellenwert genießt.
Wie können Sie nicht wissenschaftlich geschulten Normalbürgern erklären, was Sie als Physiker erforscht haben?
Gross: Ich arbeite jetzt 50 Jahre im Bereich theoretische Physik. Aber die Reise ist noch nicht zu Ende, und es ist zu früh, ein Urteil über meine Arbeit zu fällen . . .
. . . aber das haben andere schon getan und Ihnen den Physik-Nobelpreis verliehen.
Gross: Okay. Ich habe zum Verständnis von einer der elementaren Kräfte der Natur beigetragen: der starken nuklearen Kraft, welche die Elementarteilchen zusammenhält. Es gibt ja insgesamt vier Kräfte, die in einem Atom wirken. Die frühen 70er- Jahre standen im Zeichen der Vervollständigung einer umfassenden Theorie von all diesen Kräften und wie sie wirken, sowie den kleinsten Teilchen, auf deren Basis sie wirken. Das war eine große Errungenschaft, die nun allgemein akzeptiert ist.
Sie waren auch in die komplexen Prozesse des CERN-Projekts bei Genf involviert. Wie beurteilen Sie das Projekt?
Gross: CERN ringt mir größte Bewunderung ab. Man muss sich das vorstellen: Die USA wollten einen viel größeren Teilchenbeschleuniger bauen – das wäre fantastisch gewesen. Aber dann musste man dort zusperren, und CERN kam als Retter. Es wurde dort nicht nur das Higgs-Boson entdeckt, es wurde dort auch über die dunkle Materie geforscht. Sie zu entdecken und nutzbar zu machen, ist ein weiteres großes Ziel. CERN hat tausende Wissenschaftler zusammengebracht. Man darf sich darauf freuen, was dort in den weiteren Forschungen entdeckt wird.
Was für einen praktischen Nutzen werden uns Ihre Forschungserrungenschaften bringen?
Gross: Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Im Forschungsbereich der theoretischen Physik ist der spätere praktische Nutzen nicht offensichtlich. Aber eines kann ich sagen: Viele heutige Errungenschaften in Wirtschaft und Technologie gehen auf Grundlagenforschungen vor 100 Jahren zurück. Wir können oft nicht voraussehen, wozu uns verschiedene Forschungen führen. Denken Sie nur an den britischen Forscher Faraday, von dem Königin Victoria zwar schwer beeindruckt war – ihn aber trotzdem eines Tages fragte: „Wozu ist das eigentlich gut, was Sie da machen?“ Worauf er antwortete: „Das weiß ich nicht. Aber wenn daraus was wird, werden Sie es ganz sicher besteuern, Madam.“
Arbeiten Wissenschaftler wie Sie in großen Teams?
Gross: Kollegen, die in der experimentellen Physik tätig sind, tun das. Die arbeiten in riesigen Teams. Ein theoretischer Physiker wie ich tut das nicht. Ich arbeite mit Papier und Bleistift, gelegentlich mit einem Computer. Als Partner habe ich meistens ein paar Studenten.
Worin besteht der Unterschied zwischen experimentellen Physikern und theoretischen Physikern?
Gross: Der Unterschied besteht darin, dass experimentelle Physiker mit unzähligen Versuchen beweisen wollen, dass der theoretische Physiker unrecht hat. Wenn sie dann nach all diesen Versuchen feststellen müssen, dass sie den Kollegen von der theoretischen Physik nicht der Unwahrheit überführen können, fangen sie langsam an, ihm zu glauben.
Sind Sie mit dem Tempo des Fortschritts in der Physik zufrieden?
Gross: Der Fortschritt schreitet sehr schnell voran. Wenn ich mir vorstelle, was mein Verständnis über viele Dinge vor einem Jahr war und das mit der Gegenwart vergleiche, dann gibt es da große Unterschiede. Zu dieser Erkenntnis komme ich jedes Jahr.
Was verbindet Sie mit Österreich?
Gross: Mehrere Freunde aus der Welt der Physik. Ich kenne Wien und mag die Stadt und die Musik. Als Mozart-Fan will ich unbedingt einmal nach Salzburg. Kennen tue ich die Bodenseeregion. Ich war schon bei den Nobelpreisträger-Treffen in Lindau.
Zur Person
David Jonathan Gross
David Gross wurde am 19. Februar 1941 in Washington DC geboren. Für die Entdeckung der Asymptotischen Freiheit in der Theorie der starken Wechselwirkung erhielt Gross 2004 gemeinsam mit Frank Wilczek und David Politzer den Nobelpreis für Physik. Dazu kamen im Laufe seiner 50-jährigen Karriere als theoretischer Physiker zahlreiche andere Ehrungen und Preise. Prof. Gross war an mehreren Universitäten in den USA sowie der Hebrew University of Jerusalem tätig. Seit 1997 ist er an der University of California in Santa Barbara. David Gross ist verheiratet und hat zwei Kinder aus erster Ehe.